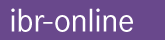Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
7689 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2014
IBRRS 2014, 0569 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Lübeck, Urteil vom 10.12.2013 - 11 O 37/12
Grundgedanke des Schadensersatzes ist der Vermögensvergleich, dass der Geschädigte durch die Ersatzleistung nicht ärmer aber auch nicht reicher gemacht werden darf. Ein Vorteilsausgleich "neu für alt" muss daher unterbleiben, wenn ein messbarer Vorteil beim Geschädigten im Verhältnis zum Wert einer Sache vor deren Beschädigung nicht feststellbar ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0565
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 04.02.2014 - 3 U 819/13
Verlangt der Werkunternehmer nach altem Recht zu Unrecht Abschlagszahlungen ohne darzulegen, auf welchen konkreten Wertzuwachs an der erbrachten Werkleistung diese sich beziehen, und kündigt er mündlich an, seine Arbeiten ohne Zahlung dieser Abschlagszahlungen nicht fortzuführen, rechtfertigt dies nicht die Besteller der Werkleistung sofort den Werkvertrag schriftlich analog § 314 BGB außerordentlich zu kündigen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0555
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Karlsruhe, Urteil vom 29.05.2012 - 8 U 173/10
1. Welcher Schallschutz bei der Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses geschuldet ist, ist durch eine Auslegung des Vertrags zu ermitteln.
2. Wird aufgrund der Vorgaben des Leistungsverzeichnisses erkennbar ein mindestens üblicher Qualitäts- und Komfortstandard geschuldet, muss ein Rohbauunternehmen auch ohne Berücksichtigung der weiteren Planung einen erhöhten Schallschutzanforderungen genügenden Rohbau entsprechend Beiblatt 2 zur DIN 4109 errichten.
3. Ordnet der mit der Bauleitung beauftragte Architekt die Verwendung eines anderen als des ausgeschriebenen Baumaterials an, muss der Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber vor der Ausführung informieren und die hiermit verbundene Vertragsänderung mit dem Auftraggeber abklären.
4. Ein unzureichender Schallschutz stellt einen wesentlichen Mangel dar, der den Auftraggeber dazu berechtigt, die Abnahme zu verweigern. Das gilt auch dann, wenn Fehler der Bauleitung den Mangel mitverursacht haben. Denn Fragen des Mitverschuldens spielen für die Abnahmefähigkeit der Werkleistung keine Rolle.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0535
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Urteil vom 11.01.2012 - 13 U 1004/11
1. Die vorbehaltslose Bezahlung einer (Abschlags-)Rechnung über eine zusätzliche Leistung enthält keine Aussage des Auftraggebers, zugleich den Bestand der erfüllten Forderungen insgesamt oder in einzelnen Beziehungen außer Streit stellen zu wollen.
2. Abschlagszahlungen sind Anzahlungen in Bezug auf den Vergütungsanspruch für das Gesamtwerk. Nach Beendigung des Vertrags hat der Auftragnehmer seine Leistungen endgültig abzurechnen. Diese Verpflichtung folgt aus der Abrede über die vorläufigen Zahlungen und besteht unabhängig davon, ob sie im Vertrag ausdrücklich geregelt ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0498
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Jena, Urteil vom 19.12.2012 - 2 U 34/12
Muss der Besteller eine § 648a-Sicherheit über 83.758,43 Euro sowie für einen Nachtrag stellen und übergibt er dem Unternehmer eine Bürgschaft über 72.678,24 Euro und eine weitere Bürgschaft für den Nachtrag mit der Einschränkung "falls sich im Nachhinein heraus stellt, dass die Forderungen aus dem Nachtrag ganz oder teilweise berechtigt sind", kann die Bürgschaft für den Nachtrag nicht zur Realisierung von Forderungen aus dem ursprünglichen Leistungsumfang herangezogen werden. Damit hat der Besteller keine ausreichende Sicherheit gestellt.
IBRRS 2014, 0487
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 04.12.2012 - 3 U 102/09
1. Jeder Unternehmer muss prüfen, ob die Vorarbeiten eines anderen Unternehmers, auf denen seine eigene Leistung aufbaut, eine geeignete Grundlage bilden und keine Eigenschaften besitzen, die den Erfolg seiner eigenen Arbeit in Frage stellen könnten. Muss er insoweit Bedenken haben, hat er sie dem Auftraggeber mitzuteilen. Diese Prüfungs- und Anzeigepflicht des Unternehmers besteht nicht nur, wenn die Parteien die VOB/B vereinbart haben, sondern bei jeglichem Bauvertrag.
2. Ein Dachdecker, der sich zur Neueindeckung eines Daches verpflichtet hat, muss den Besteller darauf hinweisen, dass das Vorgewerk "Unterspannbahn" unübersehbare Schäden (Durchlöcherung, Herabhängen, Risse) aufweist. Kommt er dieser Hinweispflicht nicht nach, muss er Schadensersatz zahlen.
3. Der Unternehmer, der seine Prüfungs- und Anzeigepflicht verletzt hat, kann nur auf Nachbesserung seiner eigenen Bauleistungen in Anspruch genommen werden. Der Schadensersatzanspruch ist deshalb auf diejenigen Kosten begrenzt, die seine eigene Leistung betreffen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0425
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Beschluss vom 03.01.2014 - 5 U 1310/13
1. Auch beim VOB/B-Bauvertrag kann trotz fehlender Abnahme sofort auf Werklohnzahlung geklagt werden, wenn das Werk mangelfrei und damit abnahmereif ist.
2. Bloßen Zweifeln des Auftraggebers an der Stärke der Betonbewehrung von Ringankern muss nicht weiter nachgegangen werden, wenn eine Bewehrung zweifelsfrei vorhanden ist und deren genaue Stärke nur mit Mitteln festgestellt werden kann, die eine weitreichende Zerstörung von Bauteilen erfordern.
3. Macht der Hauptunternehmer gegenüber der Zahlungsklage seines Nachunternehmers ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer durch Bauverzögerung vom Hauptunternehmer verwirkten Vertragsstrafe geltend, muss die Gegenforderung konkret dargestellt und beziffert werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0418
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Urteil vom 26.02.2013 - 9 U 123/12
1. Wird in einer Position eines detaillierten Leistungsverzeichnisses eine Leistung (hier: eine Behelfsbrücke) funktional beschrieben, bringt der Auftraggeber dadurch zum Ausdruck, dass es Sache des Auftragnehmers ist, auf Grundlage der dem Vertrag zugrunde liegenden Planung die für eine funktionierende und zweckentsprechende Technik notwendigen Einzelheiten zu ermitteln. Damit wird das Risiko, welche statischen und konstruktiven Erfordernisse zu erfüllen sind, in zulässiger Weise auf den Auftragnehmer verlagert.
2. Macht der Auftraggeber Schadensersatz wegen verzögerter Bauausführung geltend, muss er konkret darlegen, welche zusätzlichen Leistungen im Einzelnen wegen des Verzugs des Auftragnehmers mit seiner Leistung erforderlich waren.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0414
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 22.01.2014 - 5 U 1060/13
Ein Nachunternehmer (hier: ein Dachdecker) kann dem Bauherrn trotz fehlenden Vertrags wegen Eigentumsverletzung auf Schadensersatz (hier: wegen Feuchtigkeitsschäden im Ober- und Erdgeschoss) haften. Voraussetzung hierfür ist, dass die Schäden im Einzelfall nicht mit dem Werkmangel stoffgleich sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0405
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 20.12.2011 - 13 U 877/11 Bau
1. Der Auftragnehmer verschweigt eine Mangel arglistig, wenn er den Mangel kennt, für erheblich hält, dennoch Mangelfreiheit vorspiegelt oder den Mangel nicht mitteilt oder beseitigt, obwohl er nach Treu und Glauben, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des Mangels, zur Offenbarung verpflichtet wäre. Arglist setzt dabei immer Kenntnis vom Mangel voraus; bloße Nachlässigkeiten reichen nicht aus.
2. Organisationsverschulden ist ein dem arglistigen Verschweigen gleichgestelltes Verhalten, bei dem ein Auftragnehmer ein Werk arbeitsteilig herstellen lässt, seine Organisationspflicht bei Herstellung und Abnahme des Bauwerks verletzt hat und infolge dieser Verletzung ein Mangel nicht erkannt wurde, der bei richtiger Organisation entdeckt worden wäre.
IBRRS 2014, 0385
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Beschluss vom 08.02.2012 - 13 U 2928/11 Bau
Ein Ausschluss der Mängelrechte aufgrund einer vorbehaltlosen Abnahme (BGB § 640 Abs. 2) kommt nur in Betracht, wenn der Auftraggeber in positiver Kenntnis des Mangels die Abnahme vornimmt. Bloß fahrlässige Kenntnis des Mangels ist für den Verlust der Gewährleistungsrechte nicht ausreichend.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0366
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Bremen, Urteil vom 16.01.2014 - 3 U 44/13
Leistet der zu Abschlagszahlungen verpflichtete Besteller versehentlich eine Abschlagszahlung doppelt, so ist diese Überzahlung auf Grund der vertraglichen Beziehung der Parteien im Rahmen der Schlussrechnung auszugleichen. Bereicherungsrechtliche Vorschriften sind auch bei versehentlichen Doppelleistungen von Abschlagszahlungen nicht anwendbar.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0337
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Aachen, Urteil vom 20.09.2013 - 7 O 312/12
1. Die vorbehaltslose Abnahme hat auch bei Bauverträgen nach VOB die Wirkungen des § 640 Abs. 2 BGB, wonach dem Auftraggeber die Gewährleistungsrechte bei Abnahme eines mangelhaften Werkes nur dann zustehen, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei Abnahme vorbehält. Ein Ausschluss der Mängelrechte kommt jedoch nur in Betracht, wenn der Auftraggeber in Kenntnis des Mangels die Abnahme vornimmt, wozu das positive Wissen des Auftraggebers gehört, durch welchen Fehler der Wert oder die vertragsmäßige Tauglichkeit des Werkes aufgehoben oder gemindert wird. Bloßes Kennenmüssen reicht für den Ausschluss der Gewährleistungsansprüche nicht aus.
2. Auch im VOB-Vertrag steht dem Auftraggeber bei Mängel ein Anspruch auf Kostenvorschuss zu.
3. Einer Fristsetzung zur Mängelbeseitigung bedarf es nicht, wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer unter Vorlage eines Sachverständigengutachtens dazu auffordert, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen und der Auftragnehmer diese Forderung zurückweist und damit die Nacherfüllung verweigert.
4. Die Auftragnehmer kann die Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit verweigern, wenn mit der Nachbesserung der in Richtung auf die Beseitigung des Mangels erzielbare Erfolg bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen Verhältnis zur Höhe des dafür erforderlichen Aufwandes steht. Unverhältnismäßigkeit ist daher nur dann anzunehmen, wenn einem objektiv geringen Interesse des Bestellers an einer völlig ordnungsgemäßen vertraglichen Leistung ein ganz erheblicher und deshalb vergleichsweise unangemessener Aufwand gegenübersteht, der unter Abwägung aller Umstände einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellt. Hierbei ist zu Lasten des Auftragnehmers auch zu berücksichtigen, ob und in welchem Ausmaß er den Mangel verschuldet hat.
5. Baut der Auftragnehmer vorsätzlich ein anderes als das vertraglich vereinbarte Material ein, obwohl im Leistungsverzeichnis das einzubauende Bettungsmaterial konkret bezeichnet ist, ist die Mängelbeseitigung nicht unverhältnismäßig.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0328
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Beschluss vom 11.11.2011 - 13 U 2928/11 Bau
Der Auftragnehmer haftet unabhängig von den Angaben des Herstellers für Mängel, auch wenn er sie nicht zu vertreten hat. Nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs kommt es auf ein Verschulden an.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0307
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Frankenthal, Urteil vom 17.12.2013 - 6 O 457/12
1. Vereinbaren die Parteien eine förmliche Abnahme, so hat diese grundsätzlich stattzufinden. Nur in ganz engen Ausnahmefällen ist von der konkludenten Aufhebung der förmlichen Abnahme auszugehen.
2. Eine konkludente Aufhebung des förmlichen Abnahmeerfordernisses kommt nicht in Betracht, wenn der Auftraggeber eine umfangreiche Mängelbeseitigungsaufforderung rechtzeitig nach Inbezugnahme des Objekts an den Auftragnehmer verschickt, mit dem Vermerk, dass nach Beseitigung dieser Mängel einer förmlichen Abnahme nichts im Wege steht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0220
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.10.2009 - 5 U 70/08
1. Eine vertragliche Vereinbarung der Parteien über die Werkqualität hat Vorrang vor dem Mängelkriterium der anerkannten Regeln der Technik. Die Parteien können also auch unter dem Regime der VOB/B nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit eine Bauausführung vereinbaren können, die von den anerkannten Regeln der Technik abweicht, ohne dass deren Mindeststandard gewährleistet wird.
2. Damit dieser Vorrang auch tatsächlich greift und der Werkunternehmer trotz Verstoßes gegen die anerkannten Regeln der Technik bei Einhaltung der vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung nicht gewährleistungspflichtig ist, muss allerdings eine klare Absprache bestehen, nach der der Verstoß gegen anerkannte Regeln die vertragsgemäße Erfüllung nicht hindern soll.
3. Ein Mangel liegt trotz eines Verstoßes gegen die anerkannten Regeln der Technik nicht vor, wenn mit diesem Verstoß keine nachweisbaren Risiken verbunden sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0208
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 03.12.2013 - 9 U 747/13 Bau
Erklärt sich der Auftraggeber unter Ablehnung der angebotenen Kostenübernahme mit der technischen Ausgestaltung einer provisorischen Einhausung einverstanden und führt der Auftragnehmer die Leistung daraufhin ohne weitere Erklärung aus, kommt ein Vertrag zustande, der eine Vergütung für die Einhausung ausschließt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0128
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Frankfurt, Urteil vom 24.01.2012 - 5 U 76/02
Nimmt der Auftraggeber die Leistung des Auftragnehmers aufgrund einer mangelhaften Nachunternehmerleistung nicht ab, hat der Nachunternehmer dem Auftragnehmer sämtliche über den (direkten) Mangel an der baulichen Anlage hinausgehenden Schäden (hier: Lager-, Wartungs- und Personalkosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro) zu ersetzen, wenn der Mangel auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0098
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Heidelberg, Urteil vom 07.11.2013 - 3 O 342/12
1. Aufgrund der zwangsläufigen Unebenheiten des Untergrunds gibt es praktisch keinen hohlstellenfreien Parkettboden. Kleinflächige Hohlstellen sind demzufolge normal und stellen daher keinen Mangel der Leistung eines Parkettlegers dar.
2. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik gehört auch beim BGB-Werkvertrag zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Mindestbeschaffenheit. Werden die anerkannten Regeln der Technik nicht beachtet, ist das Werk des Unternehmers allein deshalb ohne weiteres mangelhaft.
3. Bei Mängeln eines Bauwerks kann es mit Blick auf die sogenannte Erfolgshaftung des Werkunternehmers angebracht sein, hinsichtlich der Höhe der Minderung auf die Kosten abzustellen, die zur Beseitigung des Mangels erforderlich sind. Die Berechnung der Minderung nach den Kosten der Mangelbeseitigung bzw. Nacherfüllung ist jedoch nicht möglich, wenn die Mangelbeseitigung nicht durchführbar oder unverhältnismäßig ist. Die Höhe der Minderung kann aber auch dann geringer sein, wenn zwar die Nacherfüllung nicht unverhältnismäßig ist, die Herabsetzung der Vergütung um die vollen Nacherfüllungskosten jedoch in einem auffälligen Missverhältnis zum Gesamtwert steht und daher unverhältnismäßig erscheint.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0049
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 16.10.2013 - 12 U 3/13
Bei zu heißem Badewasser handelt es sich um eine vor sich selbst warnende Gefahr. Sinn und Zweck der DIN-EN806-2, DIN 1988 ist es, so gut wie möglich vor Verbrühungen zu schützen. Bei einer Badewannenarmatur kann dieser Schutz, insbesondere von Personen, die die Gefahr nicht selbst erkennen können, auch durch Absperrhähne außerhalb der Badewanne herbeigeführt werden. Eine "klassische" Temperaturbegrenzung ist dann nicht zwingend und dessen Fehlen kein Mangel.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0041
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.12.2013 - 22 U 67/13
1. Einschränkungen der "thermischen Behaglichkeit" in einem wintergartenähnlich gestalteten Wohnraum begründen nicht ohne weiteres die Annahme eines Werkmangels einer Fußbodenheizungsanlage bzw. die Annahme einer diesbezüglichen Aufklärungs-/Bedenkenhinweispflicht des Werkunternehmers.*)
2. Auf eine Aufklärung bzw. Hinweise des Werkunternehmers bezüglich solcher Umstände, die nicht zu einem Mangel dessen Werkleistung führen, hat der Auftraggeber grundsätzlich keinen Rechtsanspruch, weil das Gewährleistungsrecht sich insoweit regelmäßig als vollständige, abschließende Regelung der beiderseitigen Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Vertragsleistung (insbesondere der "leistungsbezogenen Pflichten" des Werkunternehmers) darstellt.*)
3. Nur in besonderen Ausnahmefällen können sich unter Umständen Schutz- und Sorgfaltspflichten der Vertragsparteien auch in Bezug auf nicht gewährleistungsrelevante Umstände ergeben; diese Ausnahmen sind jedoch wegen des grundsätzlichen Vorrangs des Gewährleistungsrechts eng zu fassen.*)
4. Ein Bausachverständiger kann zwar auch zum Umfang der (technischen) Verantwortlichkeit bzw. im Rahmen von "Verursachungs- bzw. Verantwortungsquoten" Ausführungen treffen, die indes das Gericht - in einem weiteren Schritt - unter Berücksichtigung aller sonstigen tatsächlich und rechtlich maßgeblichen Umstände eigenständig der allein ihm zustehenden Rechtsprüfung zu unterziehen hat.*)
5. Den Auftraggeber trifft im Rahmen einer von ihm geltend gemachten Verletzung von Beratungs-/Bedenken-/Hinweispflichten grundsätzlich die volle Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden Kausal-/Zurechnungszusammenhang.*)
6. Konnte bzw. kann den vom Auftraggeber gerügten Einschränkungen der sog. "thermischen Behaglichkeit" auf verschiedene Weisen entgegengewirkt werden, ist die Vermutung sog. aufklärungsgerechten Verhaltens (i.S. eines Anscheinsbeweises) nicht anwendbar. Der Auftraggeber muss sich im Rahmen seines Prozessvorbringens vielmehr festlegen, welche (hypothetische) Entscheidung er auf eine - unterstellt notwendige und pflichtgemäße Aufklärung seitens Werkunternehmers - getroffen hätte. Das Vorbringen des Auftraggebers, er habe "möglicherweise" seine Planung geändert bzw. "möglicherweise" einen anderen Fußbodenbelag gewählt, ist insoweit unzureichend.*)
Online seit 2013
IBRRS 2013, 5299 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 12.09.2013 - 2 U 183/12
Das Bestehen eines Leistungsverweigerungsrechtes des Bestellers gegenüber dem Werklohnanspruch des Unternehmers im Hinblick auf die noch ausstehende Beseitigung von nachträglich zu Tage getretenen Baumängeln setzt voraus, dass das Vertragsverhältnis noch fortbesteht. Dessen wirksame Kündigung wegen nicht fristgerechter Beseitigung dieser Mängel führt zum Erlöschen auch des Leistungsverweigerungsrechts und zur Wandlung des gesamten Vertragsverhältnisses in ein reines Abrechnungsverhältnis.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5291
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 04.12.2013 - 14 U 74/13
1. Ein Bauträger (Hauptunternehmer) kann gegenüber seinem Nachunternehmer keinen Schadensersatzanspruch wegen mangelhafter Leistung geltend machen, wenn feststeht, dass der Bauträger (Hauptunternehmer) vom Käufer (Bauherrn) seinerseits nicht mehr wegen dieser mangelhaften Leistung in Anspruch genommen werden kann.*)
2. Ist die Mangelbeseitigung noch möglich, so steht dem Bauträger (Hauptunternehmer) jedoch ein Leistungsverweigerungsrecht gegenüber seinem Nachunternehmer zu.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5290
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Koblenz, Urteil vom 16.01.2013 - 5 U 748/12
1. Da die Gewährleistungspflicht nach § 13 Nr. 5 VOB/B kein Verschulden voraussetzt, entlastet es einen Fliesenleger nicht, dass die unzureichende Adhäsion der verlegten Fliesen für ihn nicht erkennbar war. Außerhalb der Schadensersatzhaftung nach § 13 Nr. 7 VOB/B kommt auch ein Abzug "neu für alt" nicht in Betracht.
2. Will ein Bauhandwerker seine Arbeiten mit Billigung des Architekten in einer vom Gewöhnlichen abweichenden Weise ausführen (hier: Ausgleich der Unebenheit des Untergrundes durch Fixierung der Fliesen auf Mörtelbatzen), muss er die dagegen anzumeldenden Bedenken gegenüber dem Bauherrn erklären.
3. Ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik ist unerheblich, wenn damit keine nachweisbaren Risiken verbunden sind (hier: Entkopplungsmatten unter einem Fliesenbelag).
4. Ist eine Abweichung vom Üblichen nicht vorgegeben, muss der Architekt einfache handwerkliche Routinearbeiten nicht überwachen (hier: Vorbereitung des Untergrunds und Verlegung von Fliesen). Dass er gleichwohl Unzulänglichkeiten entdeckt und nicht beanstandet hat, muss der Bauherr beweisen.
IBRRS 2013, 5273
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 02.10.2013 - 12 U 5/13
1. Bei der Angabe in einem (Abnahme-)Protokoll, wonach die Arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet waren und die Abnahme "vorbehaltlich der laut Anlage aufgeführten Mängel" erklärt wird, handelt es sich lediglich um einen Mängelvorbehalt. Die Abnahmewirkung tritt trotz eines solchen Vorbehalts ein.
2. Eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist entbehrlich, wenn der Auftragnehmer die Einrede der Verjährung erhebt und dadurch erkennbar endgültig eine Beseitigung der gerügten Mängel ablehnt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5237
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Karlsruhe, Urteil vom 06.08.2013 - 19 U 99/12
1. Kumulieren sich die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vorgegebene Gewährleistungssicherheit und eine "Kombi"-Bürgschaft, die neben der Vertragserfüllung auch die Gewährleistungsansprüche sichern soll (z. B. KEFB-Sich 1), über einen nicht unerheblichen Zeitraum auf 8% führt dies zur Nichtigkeit beider Sicherungsklauseln aufgrund unangemessener Übersicherung.
2. Hierbei ist es unerheblich, ob - wie im vom BGH (IBR 2011, 409) entschiedenen Fall - eine Gewährleistungsbürgschaft auf erstes Anfordern oder eine einfache Gewährleistungsbürgschaft verlangt wird.
3. Schon die in der Klausel verlangten Voraussetzungen für eine Ablösung der hohen "Kombi"-Bürgschaft durch eine geringere Gewährleistungsbürgschaft "nach Empfang der Schlusszahlung" und "Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche" stellen - für sich genommen - ein Indiz für eine Schmälerung der berechtigten Interessen der Hauptschuldnerin dar.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5190
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2013 - 22 U 211/12
1. Gibt der Auftragnehmer im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber ein vorheriges Sicherheitsverlangen gemäß § 648a BGB auf bzw. modifiziert er es erheblich, stellt dies - auch unter Berücksichtigung von § 648a Abs. 7 BGB - keinen unzulässigen Verzicht des Unternehmers auf seine Rechte aus § 648a BGB, sondern eine zulässige Selbstbeschränkung des Auftragnehmers dar.*)
2. Scheitert eine solche Vereinbarung am Ausbleiben von Bedingungen i.S.v. § 158 BGB und haben die Parteien auch nicht - zumindest hilfsweise - sonstige Abreden getroffen, ist das Verfahren gemäß § 648a BGB nicht lediglich "unterbrochen", sondern das Verfahren richtet sich ab diesem Zeitpunkt wieder nach den gesetzlichen Vorschriften.*)
3. An die Bestimmtheit eines Sicherheitsverlangens mit Fristsetzung i.S.v. § 648a BGB sind als (rechts)geschäftsähnliche Handlung - schon wegen der damit einhergehenden erheblichen zweistufigen Rechtswirkungen - entsprechend strenge Anforderungen zu stellen.*)
4. Bei der Prüfung, ob eine angemessene Frist zur Sicherheitsleistung i.S.v. § 648a Abs. 1 BGB gesetzt worden ist, muss auch berücksichtigt werden, ob eine unklare Rechtslage dadurch geschaffen worden, dass sich der Auftragnehmer weigert, nach dem Vertrag noch geschuldete Vorleistungen ohne zusätzliche Vergütung zu erbringen, und die Höhe der Sicherheit mangels verlässlicher Angaben in der Anforderung der Sicherheit noch durch den Auftraggeber ermittelt werden muss.*)
5. Das Erfordernis hinreichender Bestimmtheit einer Nachfristsetzung mit Kündigungsandrohung i.S.v. §§ 648a Abs. 5, 643 Satz 1 BGB folgt bereits daraus, dass es sich dabei um eine rechtsgestaltende Willenserklärung handelt.*)
6. Weisen Vertragsklauseln bei objektiver Auslegung einen hinreichend eindeutigen Inhalt auf, ist für die Anwendung der Unklarheitenregel von vorneherein kein Raum. Einen allgemeinen Grundsatz, wonach bei einer individuellen Vereinbarung Unklarheiten zu Lasten des Ausschreibenden gehen, gibt es nicht. Die Anwendung der Unklarheitenregel unterliegt den Grenzen der Inhaltskontrolle, wonach Abreden über den Gegenstand des Vertrages (Leistungsbeschreibung/Preisvereinbarungen) einer Inhaltskontrolle wegen des Grundsatzes der Vertragsfreiheit nicht unterliegen.*)
7. Bei der Kostenentscheidung ist angemessen zu berücksichtigen, dass die Abweisung der Klage als "derzeit unbegründet" einem Teilunterliegen gleichsteht, zumal der Auftraggeber den Werklohnanspruch damit nur vorläufig abgewehrt hat.*)
IBRRS 2013, 5183
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Beschluss vom 27.11.2013 - VII ZR 371/12
1. Wird in einer Vertragsstrafenklausel wegen der strafbewehrten Fristen auf eine weitere Klausel Bezug genommen, in der die Fertigstellungsfrist neben anderen Fristen gesondert aufgeführt ist, so liegt insoweit eine trennbare Regelung der Vertragsstrafe vor, die einer eigenständigen Inhaltskontrolle unterzogen werden kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - VII ZR 73/98, IBR 1999, 157 = BauR 1999, 645).*)
2. Eine Zulassung der Revision ist nicht allein deshalb geboten, weil andere Oberlandesgerichte als das Berufungsgericht vereinzelt von einer gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweichen, ohne diese Abweichung zu begründen.*)
IBRRS 2013, 5175
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.11.2013 - 23 U 15/13
1. Die Abnahme kann nicht nur ausdrücklich, sondern auch konkludent, das heißt durch schlüssiges Verhalten erklärt werden. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Auftraggeber die Rechnung des Auftragnehmers prüft und bezahlt, ein Schreiben des Auftragnehmers, in dem dieser auf eine aus seiner Sicht erklärte Abnahme hinweist, nicht beantwortet, er keine Mängelrügen erhebt und eine Gewährleistungsbürgschaft annimmt, die erst nach der Abnahme zu stellen ist.
2. Die Vereinbarung einer förmlichen Abnahme schließt die Möglichkeit der Abnahme durch konkludente Erklärung nicht aus, wenn die Parteien (konkludent) von der vereinbarten förmlichen Abnahme abgerückt sind.
3. Stellt der Auftraggeber das vom Auftragnehmer errichtete Bauwerk fertig, steht dem Auftragnehmer der vereinbarte Werklohn in voller Höhe selbst dann zu, wenn er Teile der von ihm geschuldeten Leistung nicht erbracht hat. Denn in einem solchen Fall hat es der Auftraggeber unmöglich gemacht, dass der Auftragnehmer nicht ausgeführte Leistung noch erbringt.
4. Bei der Beurteilung, ob eine Schlussrechnung prüfbar ist, ist nicht nur Inhalt der Schlussrechnung selbst zu berücksichtigen. Vielmehr sind auch ergänzende Angaben und Erläuterungen heranzuziehen.
5. Auf die Frage der Prüfbarkeit der Schlussrechnung kommt es nicht an, wenn der Auftraggeber die Rechnungen geprüft hat. Der Auftraggeber, der eine Rechnung prüft, kann deshalb nicht mit dem Einwand gehört werden, die Rechnung sei tatsächlich nicht prüfbar gewesen.
6. Der Sicherheitseinbehalt ist als Aufschub der Fälligkeit eines Teils des Werklohns zu qualifizieren. Der Erfolg einer auf Auszahlung des Sicherheitseinbehalts gerichteten Klage setzt danach voraus, dass der Werklohnanspruch in Höhe des eingeklagten Betrags begründet und fällig ist. Aus diesem Grunde ist es für eine Klage auf Auszahlung des Sicherheitseinbehalts erforderlich, die Fälligkeit und Höhe des Werklohnanspruchs darzulegen und zu beweisen.
7. Die Klausel eines Bauvertrags, wonach der Bürge "den verbürgten Betrag oder jedweden Teilbetrag bis in Höhe des verbürgten Betrags dem aus der Bürgschaft begünstigten Auftraggeber auszahlen [muss], wenn ihm versichert wird, dass der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus der Gewährleistung für seine Leistungen nicht oder teilweise nicht nachgekommen ist", verpflichtet den Auftragnehmer, eine Bürgschaft auf erstes Anfordern zu stellen. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers ist eine solche Klausel unwirksam.
IBRRS 2013, 5167
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 21.11.2013 - VII ZR 275/12
Ob eine Hof- und Zugangsfläche einer Wohnanlage ein Gefälle zum leichteren Abfluss von Oberflächenwasser haben muss, kann nicht allein danach beurteilt werden, dass es in der Baubeschreibung nicht vorgesehen und auch nicht zwingend erforderlich ist. Es kommt vielmehr darauf an, ob der Besteller ein solches Gefälle nach den dem Vertrag zu Grunde liegenden Umständen, insbesondere dem vereinbarten Qualitäts- und Komfortstandard, erwarten kann.*)
IBRRS 2013, 5155
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.10.2013 - 22 U 81/13
1. An die tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme einer endgültigen Erfüllungsverweigerung durch den Auftragnehmer sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt nicht bereits ohne Weiteres in dem Bestreiten von Mängeln, denn dies ist ein prozessuales Recht des Unternehmers, solange seine Verteidigung - unter Berücksichtigung des versprochenen Werkerfolgs bzw. des konkreten Mangeleinwandes - nicht "aus der Luft gegriffen" ist bzw. dem Auftragnehmer deren Haltlosigkeit - etwa mit Hilfe eines Sachverständigen - einsichtig gemacht worden ist. Der Auftragnehmer muss eindeutig zum Ausdruck bringen, er werde seinen Vertragspflichten nicht nachkommen; es muss daher als ausgeschlossen erscheinen, dass er sich von einer Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung noch umstimmen lässt. Das Bemühen des Auftragnehmers um eine gütliche Einigung und eine damit verbundene "Gesprächsbereitschaft" stehen der Annahme einer endgültigen Erfüllungsverweigerung regelmäßig entgegen.*)
2. Die Annahme einer ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung seitens des Auftragnehmers setzt zudem regelmäßig voraus, dass der Auftraggeber ihn überhaupt zunächst mit dem notwendigen Inhalt (insbesondere ohne unzulässige Bedingungen bzw. Einschränkungen) zur Nacherfüllung aufgefordert hat, zumal es grundsätzlich dem Unternehmer überlassen bleibt, in welchem Umfang und auf welche konkrete Weise er einen Baumangel beseitigen will. Anderes gilt insbesondere gemäß § 242 BGB im Falle der Ankündigung bzw. Durchführung zweifelsfrei unzureichender bzw. untauglicher Erfüllungs- bzw. Nacherfüllungsmaßnahmen des Auftragnehmers.*)
3. Die Erhebung einer Klage des Auftragnehmers auf Zahlung des gesamten Restwerklohns rechtfertigt nicht die Annahme endgültiger Erfüllungsverweigerung, wenn der Auftraggeber durch eine unberechtigte Ersatzvornahme dem Auftragnehmer die Möglichkeit einer Nacherfüllung genommen hat, die Annahme einer Verweigerung einer (nicht mehr verlangten) Nacherfüllung damit denknotwendig ausscheidet und das Verhalten des Auftragnehmers daher als zulässiges sog. prozesstaktisches Bestreiten bewertet werden kann.*)
4. Beseitigt der Auftraggeber einer Werkleistung von ihm behauptete Mängel der Werkleistung selbst, ohne dem Werkunternehmer zuvor eine erforderliche hinreichende Möglichkeit zur etwaig erforderlichen Nacherfüllung gegeben zu haben, ist er mit diesbezüglichen Gewährleistungs- bzw. Ersatzansprüchen aus allen dafür in Betracht kommenden Rechtsgründen ausgeschlossen. Der abschließende Charakter der gesetzlich normierten Gewährleistung verbietet insbesondere eine unmittelbare oder entsprechende Anwendung des § 326 BGB bzw. der Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. des Bereicherungsrechts.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5141
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.10.2013 - 22 U 21/13
1. Eine ausdrückliche oder konkludente Anordnung des Auftraggebers i.S.v. § 2 Nr. 5 VOB/B erfordert eine rechtsgeschäftlichen Erklärung. Allein die Mitteilung des Auftragnehmers an den Auftraggeber, es lägen veränderte Umstände vor, genügt nicht. Selbst wenn die Veränderung der Bauumstände - wie z.B. durch ein unzureichendes Leistungsverzeichnis - aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers stammt, rechtfertigt allein eine Bauablaufstörung nicht ohne weiteres die Annahme einer Anordnung.*)
2. Diese strengen Anforderungen an eine Anordnung benachteiligen den Auftragnehmer nicht unzumutbar, da ihm während des Bauablaufs die Möglichkeit offen steht, ein Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich nicht vom Vertrag umfasster Leistungen geltend zu machen und auf eine Anordnung bzw. eine Einigung zu bestehen. Stellt sich heraus, dass der Auftraggeber eine Anordnung hätte treffen müssen, diese jedoch unterlassen hat und es dadurch zu einer Behinderung oder Unterbrechung der Bauausführung gekommen ist, ist der Auftragnehmer durch Ansprüche aus § 6 Nr. 2 bzw. Nr. 6 VOB/B regelmäßig hinreichend abgesichert.*)
3. Bei der Vereinbarung eines "neuen Preises" unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Minderkosten i.S.v. § 2 Nr. 5 Satz 2 VOB/B handelt es sich lediglich um eine Sollbestimmung und nicht um eine Anspruchsvoraussetzung.*)
4. Grundlage für die Festlegung des neuen Preises ist stets der zuvor vereinbarte Preis. Diesem werden die vorauskalkulierten bzw. im Voraus zu kalkulierenden Mehrkosten im Zeitpunkt der Kalkulation des Nachtragsangebots nach erfolgter Bauentwurfsänderung hinzugerechnet bzw. von diesem werden die entsprechenden Minderkosten abgezogen. Dies erfordert die Vorlage der ursprünglichen Angebotskalkulation. Fehlt diese, ist vom Auftragnehmer nachträglich eine plausible Kalkulation für die vereinbarten Vertragspreise zu erstellen und der neuen Kalkulation für den geforderten Nachtragspreis nachvollziehbar gegenüberzustellen. Andernfalls ist ein dazu geltend gemachter Mehrvergütungsanspruch bei Nachträgen unschlüssig und die Klage nicht nur als derzeit, sondern als endgültig unbegründet abzuweisen. Für einen Rückgriff auf den ortsüblichen Preis in Anlehnung an § 632 Abs. 2 BGB ist insoweit kein Raum. Ohne hinreichende Anschlusstatsachen bzw. Schätzungsgrundlagen verbietet sich auch eine gerichtliche Schätzung gemäß § 287 ZPO.*)
5. Maßgeblich im Rahmen von § 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 2 VOB/B ist in erster Linie das nach außen erkennbar gewordene Verhalten des Auftraggebers, welches der Auftragnehmer mit zumutbarem Aufwand erforschen und selbst dann beachten muss, wenn es ihm als unvernünftig bzw. interessenwidrig erscheint. § 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 2 VOB/B ist die abschließende Formulierung eines Ausnahmetatbestandes und nicht dazu geeignet, im Sinne einer unzureichend reflektierten Generalklausel bzw. Auffangvorschrift dem Auftragnehmer zusätzliches Entgelt zu verschaffen.*)
IBRRS 2013, 5124
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Mainz, Urteil vom 30.10.2013 - 9 O 42/11
1. Der BGH stellt nicht auf die Angebotspreise ab, sondern auf die (hypothetischen) Preise, die bei Einhaltung der geplanten Bauzeit hätten gezahlt werden müssen. Es dürfen hierbei aber nur die Mehrkosten Berücksichtigung finden, die ursächlich auf die Verschiebung der Bauzeit zurückzuführen sind.
2. Der Bezeichnung "freibleibend" (Nachunternehmerangebot) kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu, zumal wenn der Zusatz üblicherweise erfolgt, sich aber die Firma gleichwohl an ihre Gebote gebunden fühlt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5099
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.11.2013 - 22 U 32/13
1. Inhalt eines Sachverständigengutachtens dürfen grundsätzlich nur die aufgrund besonderen (dem Gericht regelmäßig fehlenden) Fachwissens zu treffenden Wertungen, Schlussfolgerungen und Hypothesen sein, die der Sachverständige aufgrund ihm vorgegebener Tatsachen (Anschluss-/Anknüpfungstatsachen) unter Berücksichtigung des (fachlichen) Verständnisses innerhalb des jeweils betroffenen Verkehrskreises darzustellen hat. Der Sachverständige darf auch zum Umfang der (technischen) Verantwortlichkeit im Rahmen von Verursachungs- bzw. Verantwortungsquoten Ausführungen treffen, die das Gericht sodann - in einem weiteren Schritt - unter Berücksichtigung aller sonstigen tatsächlich und rechtlich maßgeblichen Umstände - rechtlich eigenständig zu bewerten hat.*)
2. Eine Mitverantwortung der Auftraggeberin wegen eines Planungsverschuldens kommt auch dann in Betracht, wenn Teilbereiche vertragswidrig überhaupt nicht geplant worden sind und der Mangel auf die unterlassene Planung zurückzuführen ist. Voraussetzung für die Anrechnung eines Mitverschuldens ist aber, dass die Planungsverantwortung, welche originär die Auftraggeberin selbst trifft, auch bei ihr verblieben ist, d.h. von ihr nicht wirksam auf die Auftragnehmerin delegiert worden ist. Übernimmt die Auftragnehmerin Werkleistungen in Kenntnis des Umstandes, dass die Auftraggeberin keine oder nur eine unzureichende Planung zur Verfügung gestellt hat, so kann sie sich nicht ohne weiteres auf ein Mitverschulden der Auftraggeberin berufen.*)
3. Eine zu Lasten der Auftraggeberin wirkende Koordinierungspflichtverletzung liegt regelmäßig erst dann vor, wenn diese Pflichtverletzung - faktisch - einem Planungsfehler gleichsteht bzw. zumindest nahekommt.*)
4. Die Höhe der sog. Regiekosten (insbesondere Architektenkosten) für eine etwaig notwendige Planung bzw. Überwachung der Mängelbeseitigung kann im Regelfall gemäß §§ 249 BGB, 287 ZPO in Höhe von ca. 10-15 % der Mängelbeseitigungskosten geschätzt werden.*)
5. Besteht die Funktion einer Werkleistung - in erster Linie oder auch im Sinne einer von mehreren Funktionen - darin, dass das Risiko bestimmter Gefahren abgewendet werden soll, ist das Werk mangelhaft, wenn das Risiko des Gefahreintritts besteht.*)
6. Beim Erlass eines Feststellungsurteils, das den Anspruchsgrund umfasst, darf nicht offenbleiben, ob die Auftraggeberin ein Mitverschulden an dem Werkmangel trifft.*)
7. Die Anschlussberufung ist nur eine Antragstellung innerhalb einer fremden Berufung und kann sich deshalb ausschließlich gegen den Berufungsführer und nicht gegen Dritte richten, insbesondere auch nicht gegen einen Beklagten, gegen den die Klage in erster Instanz abgewiesen wurde.*)
IBRRS 2013, 5029
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.08.2013 - 22 U 161/12
1. Der Auftragnehmer kann der werkvertraglichen Verpflichtung zur Vorlage von Rapporten bzw. Stundenzetteln auch noch mit der Erteilung der Schlussrechnung Genüge tun, soweit darin die erforderlichen Angaben enthalten sind bzw. nachgeholt werden. Die unterbliebene Vorlage von vertraglich vereinbarten Rapporten führt ebenso wenig wie die unterbliebene Vorlage von Stundenzetteln ohne weiteres zum Verlust des Werklohnanspruchs. Jedoch muss der Auftragnehmer dann nachträglich alle notwendigen Angaben machen, die in den Rapporten bzw. Stundenzetteln hätten enthalten sein müssen, um den Vergütungsanspruch zu rechtfertigen.*)
2. Grundsätzlich sind bei Rapporten bzw. Stundenzetteln zwecks hinreichender Prüfbarkeit für den Auftraggeber der genaue Zeitpunkt und Zeitraum der verrichteten Arbeiten anzugeben; daneben ist die Baustelle zu bezeichnen und die Leistung ist detailliert zu beschreiben. Darüber hinaus ist die Anzahl der geleisteten Stunden anzugeben, die namentlich zu erfassenden Arbeitskräften zuzuordnen sind, wenn sich daraus - abhängig von den Abrechnungsvereinbarungen im Einzelfall - ein unterschiedlicher Stundenlohn (für Hilfskräfte oder Gesellen bzw. Meister) ergibt.*)
3 § 15 Abs. 5 VOB/B eröffnet bereits nach seinem ausdrücklichen Wortlaut nur dem Auftraggeber die Möglichkeit zu einem Verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart wird, die nach der dort näher beschriebenen Maßgabe zu ermitteln ist. Dies folgt nach Sinn und Zweck von § 15 Abs. 5 VOB/B auch daraus, dass damit keinesfalls bezweckt wird, die prozessuale Beweislast zu verändern, zu beschränken bzw. zu verschieben, sondern § 15 Abs. 5 VOB/B allein dem Bestreben dient, im Vorfeld eine vertragliche Lösung zu suchen, um einen Prozess zu vermeiden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4927
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Mannheim, Urteil vom 26.04.2012 - 23 O 94/11
Den Hinweis in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers: "Selbstbeteiligung des Auftragnehmers pro Schadensfall 7.500 Euro" versteht ein verständiger Erklärungsempfänger als Hinweis auf eine im Rahmen der zwischen dem Auftraggeber und der Versicherung vereinbarten Selbstbeteiligung.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4883
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 25.09.2013 - 2-16 S 54/13
1. Der Auftragnehmer kann seinen Vergütungsanspruch auch ohne eine vorausgegangene Abnahme geltend machen, wenn der Auftraggeber grundlos die Abnahme ablehnt. In einem solchen Fall kann der Auftragnehmer auf Abnahme und Zahlung des Werklohns klagen. Dabei reicht ein Zahlungsantrag aus, da mit ihm konkludent die Abnahme der Werkleistung begehrt wird.
2. Klagt der Auftragnehmer mit der Behauptung, er habe die geschuldete Werkleistung vertragsgemäß erbracht, bedarf es keines ergänzenden Vortrags zur Abnahmefähigkeit, solange der Auftraggeber keine Tatsachen vorträgt, die dem entgegenstehen. Das gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber die Zahlung des Werklohns verweigert, ohne überhaupt Mängel des Werks bzw. nur ihrer Art und Umfang nach unbedeutende Mängel geltend zu machen.
3. Dem Eintritt der Fälligkeit steht das Fehlen einer den Anforderungen des UStG entsprechenden Rechnung nicht entgegen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4698
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 05.11.2012 - 17 U 5/12
Wird der Auftragnehmer auf der Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung zum Pauschalpreis mit dem Einbau von Klimageräten und dem Neuaufbau der Versorgungs- und Abwasserleitungen beauftragt, jedoch nur "ab Übergabe Versorgungsunternehmen", sind die Mehrkosten für einen Stromanschluss mit höherer Leistung vom Auftraggeber zu tragen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4681
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 23.10.2012 - 9 U 733/12
Vereinbaren die Parteien eines Bauvertrags, dass die förmliche Endabnahme spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Abnahmeantrag des Auftragnehmers erfolgt, gilt die Leistung als abgenommen, wenn der Auftraggeber die Abnahme zunächst wegen Mängeln verweigert, dann aber auf die Anzeige der Mängelbeseitigung nicht reagiert.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4602
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Urteil vom 24.07.2013 - 11 U 221/12
1. Wird ein Auftragnehmer nur allgemein mit der Demontage eines Belüftungskanals beauftragt, ist damit keine erfolgsbezogene Pflicht zur Vermeidung von Asbestgefahren verbunden. Etwas anderes gilt, wenn der Auftrag eine Asbestsanierung oder die Beseitigung von asbesthaltigen Gebäudeteilen oder Materialien zum Inhalt hat.
2. Kommt es bei der Demontage eines Belüftungskanals zu einer Verunreinigung des Gebäudes mit Asbestfasern, muss der Auftraggeber - sofern lediglich die Verletzung einer verhaltensbezogenen Nebenpflicht in Rede steht - die Verletzung einer verhaltensbezogenen Pflicht im Einzelnen darlegen und beweisen.
3. Die Untersuchungs- und Prüfungspflicht des Werkunternehmers beschränkt sich auf die technischen und handwerklichen Überprüfungen, die ihm möglich und zumutbar sind. Wird ein nicht auf die Beseitigung von Asbest spezialisierter Unternehmer im Anschluss an seinen Ursprungsauftrag mit zusätzlichen Demontagearbeiten betraut und bestehen keine Hinweise auf eine Asbestproblematik, muss der Unternehmer nicht aufs Geratewohl eine kostspielige Untersuchung auf eine rein hypothetische Asbestgefahr durchführen lassen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4580
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Stuttgart, Urteil vom 06.12.2012 - 13 U 65/12
1. Der Auftragnehmer muss beim Stundenlohnvertrag darlegen und beweisen, wie viele Stunden für die Erbringung der Vertragsleistungen angefallen sind.
2. Die Verjährungshemmung endet, wenn die Verhandlungen einschlafen, wobei die Verhandlungen in dem Zeitpunkt beendet sind, in dem der nächste Schritt nach Treu und Glauben zu erwarten war. Dieser Zeitraum kann auch ein Monat sein.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4564
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 18.09.2012 - 7 U 227/11
1. Sind vereinbarte Vertragsfristen ohne Verschulden des Auftragnehmers verstrichen und werden keine neuen Vertragsfristen vereinbart, ist der Auftragnehmer gleichwohl dazu verpflichtet, die Ausführung angemessen zu fördern und die Erstellung der vertraglich geschuldeten Werkstatt- und Montageplanung nicht zu verzögern.
2. Die Grundsätze über das kaufmännische Bestätigungsschreiben sind auf (Baustellen-)Protokolle entsprechend anwendbar. Der Auftragnehmer muss daher dem Inhalt eines vom Auftraggeber erstellten Protokolls unverzüglich widersprechen, will er verhindern, dass sein Schweigen wie eine nachträgliche Genehmigung behandelt wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4537
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.01.2013 - 21 U 25/10
1. Die Beantwortung der Frage, wer bei einem (vermeintlich) unklaren Angebot Vertragspartner wird, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei darf der Empfänger der Erklärung allerdings nicht einfach den ihm günstigsten Sinn beilegen.
2. Bei den einem Werk- bzw. Kaufvertrag vorangehenden Gesprächen zwischen den späteren Vertragsparteien bzw. deren Vertretern ist es allgemein üblich, dass der Kunde von Seiten des für den Unternehmer oder Verkäufer Auftretenden über die später zu erbringende Leistung bzw. das zu erwerbende Produkt beraten wird. Das allein begründet aber noch keinen eigenständigen Beratervertrag.
3. Die Haftung einer Person, die nicht Vertragspartner wird, setzt nach § 311 Abs. 3 BGB voraus, dass diese in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst hat. Des Weiteren ist ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Vertragsschluss erforderlich. Ein lediglich mittelbares Interesse, etwa die Aussicht auf eine Provision oder ein Entgelt genügt hierfür nicht. Angestellte, Handlungsbevollmächtigte oder Handelsvertreter haften daher nicht aus § 311 Abs. 3 BGB.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4522
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Beschluss vom 04.11.2013 - 3 U 689/13
1. Im Rahmen einer Vorschussklage kann sich der Auftraggeber einer Werkleistung zur Spezifizierung seines Vorbingens auf Kostenvoranschläge oder Privat- oder Beweissicherungsgutachten berufen. Die Höhe der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten muss von dem Auftraggeber nicht etwa durch ein vorprozessuales Sachverständigengutachten ermittelt werden. Es reicht aus, wenn er die Kosten schätzt und bei Bestreiten ein Sachverständigengutachten anbietet (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 22.02.2001 - VII ZR 115/99 - NJW-RR 2001, 739 = BauR 2001, 789 = IBR 2001, 254; Urteil vom 14.01.1999 - VII ZR 19/98 - BauR 1999, 631 f. = NJW-RR 1999, 813 = IBR 1999, 206 = MDR 1999, 609 f.).*)
2. Kann der Auftraggeber ohne eine sachverständige Beratung die ungefähre Höhe des angemessenen Vorschusses nicht angeben oder seriös schätzen, ist er sowohl zur Erhebung einer unbezifferten Leistungsklage als auch zur Einreichung einer Feststellungsklage befugt, wobei das angerufene Gericht in aller Regel den angemessenen Kostenvorschuss gemäß § 287 ZPO festsetzen kann (in Anknüpfung an OLG Hamm, Urteil vom 01.04.1998 - 12 U 146/94 - BauR 1998, 1019 ff).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4521
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Beschluss vom 17.09.2013 - 3 U 689/13
1. Im Rahmen einer Vorschussklage kann sich der Auftraggeber einer Werkleistung zur Spezifizierung seines Vorbingens auf Kostenvoranschläge oder Privat- oder Beweissicherungsgutachten berufen. Die Höhe der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten muss von dem Auftraggeber nicht etwa durch ein vorprozessuales Sachverständigengutachten ermittelt werden. Es reicht aus, wenn er die Kosten schätzt und bei Bestreiten ein Sachverständigengutachten anbietet (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 22.02.2001 - VII ZR 115/99 - NJW-RR 2001, 739 = BauR 2001, 789 = IBR 2001, 254; Urteil vom 14.01.1999 - VII ZR 19/98 - BauR 1999, 631 f. = NJW-RR 1999, 813 = IBR 1999, 206 = MDR 1999, 609 f.).*)
2. Kann der Auftraggeber ohne eine sachverständige Beratung die ungefähre Höhe des angemessenen Vorschusses nicht angeben oder seriös schätzen, ist er sowohl zur Erhebung einer unbezifferten Leistungsklage als auch zur Einreichung einer Feststellungsklage befugt, wobei das angerufene Gericht in aller Regel den angemessenen Kostenvorschuss gemäß § 287 ZPO festsetzen kann (in Anknüpfung an OLG Hamm, Urteil vom 01.04.1998 - 12 U 146/94 - BauR 1998, 1019 ff. Juris Rn. 58).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4456
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 20.08.2012 - 12 U 705/11
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4454
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Jena, Urteil vom 17.09.2013 - 5 U 904/12
Auch wenn in einem Leistungsverzeichnis konkrete Maße zur Fugenbreite zwischen den Pflastersteinen genannt sind, hat der Auftragnehmer die laut DIN für Natursteinpflaster zulässigen jedoch größeren Fugenmaße beim Hinterschnitt der Steine zu kalkulieren. Der angeordnete Einbau von Pflastersteinen, mit denen die Hinterschnitttoleranzen laut DIN eingehalten bzw. geringfügig überschritten werden, begründet keinen Mehrkostenanspruch des Baubetriebs.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4401
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamburg, Urteil vom 20.02.2012 - 11 U 103/08
1. Der Auftraggeber hat einen Anspruch auf Zahlung eines Vorschusses zur Mängelbeseitigung. Dabei muss sich der Vorschussanspruch an den tatsächlich zu erwartenden Kosten orientieren.
2. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der mit der Kostenschätzung beauftragte Sachverständige etwaigen Unsicherheiten dadurch Rechnung trägt, dass er einen pauschalen Mehrbetrag in Höhe von 10% für "Unvorhergesehenes" in die Kostenkalkulation einstellt.
3. Der Besteller kann einen Vorschuss in Höhe der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten auch dann verlangen, wenn diese Kosten die mit dem Mangel verbundene Wertminderung des Werks deutlich übersteigen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4381
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamburg, Urteil vom 28.11.2012 - 13 U 157/10
1. Der Auftraggeber kann auch im VOB-Vertrag einen Kostenvorschuss verlangen. Voraussetzung hierfür ist, dass ihm ein Anspruch auf Ersatzvornahme zusteht.
2. Maßgeblich für die Höhe des Vorschusses sind die voraussichtlichen Kosten für die Arbeiten, die erforderlich sind, um das Werk des Auftragnehmers in den vertraglich geschuldeten Zustand zu setzen. Dabei sind der Aufwand und die Kosten zu berücksichtigen, die der Auftraggeber bei verständiger Würdigung als vernünftiger und wirtschaftlich denkender Bauherr aufgrund sachkundiger Beratung für erforderlich halten darf.
3. An die Darlegungen zur Vorschusshöhe sind nicht die gleichen strengen Anforderungen zu stellen, wie an die Darlegung der Kosten einer Ersatzvornahme. Da es nur um voraussichtliche Aufwendungen und eine vorläufige Zahlung geht, müssen die voraussichtlichen Kosten nicht gleichem Maße genau begründet werden.
4. Wird ein Kostenvorschuss wegen fehlender Entwässerungskappen auf ein Sachverständigengutachten gestützt und hat der Sachverständige darin festgestellt, dass die gerügten Mängel bei ca. 50% der von ihm begutachteten Fenster vorliegen, kann daraus der Schluss gezogen werden, dass es sich um einen generellen Mangel im gesamten Bauvorhaben handelt und im gesamten Gebäudekomplex an 50% der Fenster die Entwässerungskappen fehlen. Das gilt auch dann, wenn der Sachverständige lediglich 26 von 77 Wohnungen besichtigt hat.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4345
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 08.06.2012 - 8 U 1183/10
1. Der Begriff "Stoff" in § 645 BGB umfasst alle Gegenstände, aus denen, an denen oder mit deren Hilfe das Bauwerk herzustellen ist. Dazu gehört auch die stoffliche Umgebung, in oder auf der ein Werk errichtet werden soll.
2. Bei den Bodenverhältnissen handelt es sich um einen Umstand, der als "von dem Besteller gelieferter Stoff" anzusehen ist. Soweit der Untergrund für den Bau nicht geeignet ist, trägt der Besteller das damit verbundene Risiko.
3. Auch im BGB-Bauvertrag treffen den Unternehmer Prüfungs- und Anzeigepflichten. Verletzt der Bauunternehmer seine insoweit bestehende Prüfungs- und Hinweispflicht, macht das seine an sich ordnungsgemäße Bauleistung mangelhaft, falls ein Fachmann den Mangel erkennen konnte.
4. Der Einwand, der Bauherr habe die Ausführung "so gewollt" lässt die Haftung des Unternehmers für Mängel nicht entfallen. Eine "Enthaftung" setzt vielmehr voraus, dass der Unternehmer dem Bauherrn die gravierenden Folgen seines Handelns vor Augen führt und ihn mit den Konsequenzen konfrontiert.
 Volltext
Volltext