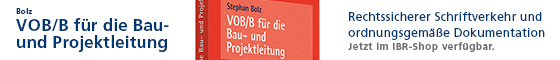Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
7838 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2024
IBRRS 2024, 3103 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 11.09.2024 - 27 U 6864/22 Bau
Eine 40-jährige "Gewährleistungsgarantie" betreffend die Konstruktion für Außenwände, die Konstruktion für Innenwände, die Deckenkonstruktion sowie die Dachkonstruktion umfasst nur die "statische Grundkonstruktion" des Gebäudes. Abdichtungen, Fugen, Schienen und Verblechungen sind davon nicht umfasst.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3119
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 10 U 102/23
1. Die Zahlung irrtümlich ohne Abzug der Bauabzugssteuer berechneten Werklohns kann einen vertraglichen Anspruch auf Rückzahlung von Überzahlungen begründen, der sich als Nebenpflicht aus dem Vertrag ergibt. Das ist nicht der Fall, wenn die Rückzahlung eines nicht angefallenen Umsatzsteueranteils im Raum steht, für die keine vertragliche Nebenpflicht besteht, so dass der Anspruch aus Bereicherungsrecht folgt.
2. Eine Bruttopreisvereinbarung führt dazu, dass die festgesetzte Umsatzsteuer als Teil des Kaufpreises geschuldet wird, unabhängig von der materiell-rechtlichen Umsatzsteuerpflicht des abgeschlossenen Geschäfts. Dabei ist regelmäßig - auch wenn sich die Vertragsparteien nicht ausdrücklich darauf verständigt haben - vom Vorliegen einer Bruttopreisabrede auszugehen.
3. Haben die Parteien eine Nettopreisabrede getroffen, führt diese dazu, dass nur der ausgewiesene Preis sowie die tatsächlich geschuldete Umsatzsteuer zu entrichten sind.
4. Die Vereinbarung zur Zahlung eines Entgelts "zuzüglich" der gesetzlichen Umsatzsteuer ist regelmäßig dahingehend auszulegen, dass die Umsatzsteuer nicht gezahlt werden muss, wenn die Umsatzsteuer irrtümlich angesetzt worden ist und das Geschäft in Wirklichkeit nicht der Umsatzsteuer unterlegen hat.
5. Die steuerrechtliche Lage ist im Zivilprozess ohne Bindung zu prüfen.
6. Der Gläubiger eines Bereicherungsanspruchs hat Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen, wenn er von der Leistung und den Tatsachen weiß, aus denen sich das Fehlen des Rechtsgrunds ergibt. Eine unzutreffende Rechtsanwendung durch die Finanzbehörden geht verjährungsrechtlich nicht zu Lasten des Anspruchsgläubigers. Der Geschädigte müsste vielmehr wissen oder grob fahrlässig nicht wissen, dass die Rechtsanwendung fehlerhaft war.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2990
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 17.05.2024 - 2-02 O 578/23
1. Das (Wiederver-)Schließen einer geöffneten Holzverkleidung verlangt Arbeiten mit Holz, die in den Fachbereich eines Schreiners fallen und außerhalb des typisierten Aufgaben- und Fachgebiets eines Heizungs- und Sanitätsbetriebs liegen und somit nicht Bestandteil eines Auftrags über die Reparatur einer an der Hausaußenwand verlegten Kaltwasserleitung sind.
2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen (Sicherungsmaßnahmen) zu treffen, um Schäden anderer - insbesondere seines Vertragspartners - zu verhindern. Er muss aber nicht für alle denkbaren, auch entfernten Möglichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge treffen. Vielmehr genügen solche Vorkehrungen, die zur Beseitigung der Gefahren erforderlich und zumutbar sind.
3. Eine Schutzpflicht zum Wiederanbringen einer Holzverkleidung, die der Auftragnehmer zuvor zum Abklemmen einer Wasserleitung entfernt hat, besteht mangels hinreichenden Zusammenhangs mit der beauftragten Reparaturleistung nicht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3117
 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 12 U 114/23
Für die Annahme eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags müssen sowohl Angebot als auch Annahme bei gleichzeitiger Anwesenheit der Vertragspartner erklärt werden. Es ist nicht ausreichend, wenn vor Ort in Anwesenheit beider Parteien lediglich ein zuvor abgegebenes Angebot des Auftragnehmers angenommen wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3109
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 10 U 80/23
1. Ein Gefälle von 0,9% unterschreitet die maßgebenden Vorschriften für genutzte Terrassen und begründet daher einen Mangel wegen Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
2. Es steht den Parteien frei, im Einzelfall von einer anerkannten Regel der Technik abzuweichen. An eine solche Beschaffenheitsvereinbarung "nach unten" sind wegen des damit einhergehenden Verzichts auf eine übliche Beschaffenheit strenge Anforderungen zu stellen. Sie kann nur angenommen werden, wenn der Besteller das damit einhergehende Risiko kannte. Der Besteller ist, selbst wenn er sachkundig sein sollte, umfassend über die Risiken und denkbaren Folgen der Bauausführung aufzuklären.
3. Im Werkvertragsrecht wird auch ein funktionstaugliches und zweckentsprechendes Werk im Sinne einer Erfolgshaftung geschuldet. Fehlt dem Werk die Funktionstauglichkeit, so ist es auch dann nicht mangelfrei, wenn es ansonsten der Leistungsbeschreibung und der vereinbarten Ausführungsart genügt.
4. Ein Mangel liegt selbst dann vor, wenn die Ursache der fehlenden Funktionstauglichkeit auf der vom Besteller erstellten Planung beruht. Allerdings kann sich der Unternehmer von seiner Haftung befreien, wenn die Ursache der fehlenden Funktionstauglichkeit nicht in seiner Sphäre liegt. Dies ist dann der Fall, (1) wenn der Unternehmer seinen Prüfungs- und Hinweispflichten nachgekommen ist, (2) wenn keine Hinweispflicht besteht, weil er die Ungeeignetheit der Planung bei der gebotenen Prüfung mit dem von ihm erwartenden Fachwissen nicht erkennen kann oder (3) wenn im Einzelfall feststeht, dass der unterlassene Hinweis sich nicht ausgewirkt hat.
5. Unverhältnismäßig sind die Kosten für die Beseitigung eines Werkmangels nur dann, wenn der damit in Richtung auf die Beseitigung des Mangels erzielte Erfolg oder Teilerfolg bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen Verhältnis zur Höhe des dafür gemachten Geldaufwands steht.
6. Dem Besteller obliegt es grundsätzlich, dem Unternehmer zuverlässige Pläne und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Bedient er sich für die ihm obliegenden Planungsaufgaben eines Architekten, ist dieser sein Erfüllungsgehilfe im Verhältnis zum Bauunternehmer, so dass der Besteller für das Verschulden des Architekten einstehen muss. Dies gilt jedoch nicht für ein etwaiges Überwachungsverschulden des Architekten.
7. Die vollständige Ausführungsplanung beinhaltet die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben, so dass auf Grundlage der ausführungsreifen Ausführungsplanung zunächst Leistungspositionen beschrieben sowie Mengen und Massen ermittelt werden können und schließlich auch die Bauausführung durch einen Unternehmer ermöglicht wird.
IBRRS 2024, 3131
 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Beschluss vom 26.09.2024 - I ZR 161/23
Kann der Auftragnehmer die von ihm erbrachten Leistung nicht durch ein Aufmaß ermitteln, genügt er seiner Verpflichtung zur prüfbaren Abrechnung, wenn er alle ihm zur Verfügung stehenden Umstände mitteilt, die Rückschlüsse auf den Stand der erbrachten Leistung ermöglichen (vgl. BGH, IBR 2004, 488).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3141
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
1. Eine Anordnung i. S. des § 2 Abs. 5 VOB/B erfordert eine rechtsgeschäftliche Erklärung des Auftraggebers, mit der einseitig eine Änderung der Vertragspflichten des Auftragnehmers herbeigeführt werden soll (Fortführung von BGH, IBR 1992, 349).*)
2. Ob ein Verhalten oder eine Erklärung des Auftraggebers als Anordnung i. S. des § 2 Abs. 5 VOB/B auszulegen ist, beurteilt sich nach §§ 133, 157 BGB. Liegt eine Störung des Vertrags aufgrund einer Behinderung vor, die faktisch zu einer Bauzeitverzögerung führt, und teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer den Behinderungstatbestand und die hieraus resultierende Konsequenz mit, dass die Leistungen derzeit nicht erbracht werden können, liegt nach diesem Maßstab keine Anordnung i. S. des § 2 Abs. 5 VOB/B vor. Auch die Übermittlung von Bauablaufplänen stellt keine Anordnung des Auftraggebers i. S. des § 2 Abs. 5 VOB/B dar, wenn mit ihnen lediglich auf behinderungsbedingte Störungen des Vertrags reagiert wird. Dies gilt auch, wenn darin im Hinblick auf die Behinderungen und die deshalb gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B verlängerten Ausführungsfristen zeitliche Konkretisierungen erfolgen.*)
3. Der Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B setzt voraus, dass die Bauzeitverzögerung adäquat-kausal durch hindernde Umstände verursacht worden ist, die auf der Verletzung einer vertraglichen Pflicht durch den Auftraggeber beruhen. Umstände aus der Risikosphäre des Auftraggebers, die nicht auf einer Pflichtverletzung beruhen, genügen nicht als Voraussetzung dieses Anspruchs (Bestätigung von BGH, IBR 2006, 84; BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98, IBRRS 2000, 0800; BGH, Urteil vom 16.10.1997 - VII ZR 64/96, IBRRS 2000, 0581).*)
IBRRS 2024, 3013
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Schleswig, Urteil vom 28.08.2024 - 12 U 7/24
1. Auch für Architekten und Ingenieure gilt der funktionale Mangelbegriff. Es werden diejenigen Planungsleistungen geschuldet, die erforderlich sind, um den vom Bauherrn angestrebten Erfolg zu erzielen. Dabei ist maßgeblich die Funktion, die das Architekten-/Ingenieurwerk nach der von den Parteien entwickelten gemeinsamen Vorstellung von dem zu errichtenden Objekt erfüllen soll.
2. Im Rahmen einer sachgerechten Beratung müssen eventuelle Risiken mit dem Bauherrn erörtert und ihm hinreichend vor Augen geführt werden, welche Folgen mit einer bestimmten Ausführung des Bauvorhabens verbunden sind.
3. Die Planung kann insofern auch fehlerhaft sein, wenn ausreichende Hinweise nicht erteilt werden und muss darauf ausgerichtet werden, dass sie dem vertraglich vorausgesetzten Gebrauch gerecht wird. Der Architekt ist verpflichtet, auf Bedenken hinzuweisen, insbesondere im Hinblick auf vom Auftraggeber unerkannte Risiken, soweit sie geeignet sind, die Leistung zu gefährden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3102
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Beschluss vom 23.07.2024 - 27 U 213/24 Bau
1. Der Inhalt einer vom Unternehmer abgegebenen „Garantie“ ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls durch Auslegung zu ermitteln. Entscheidend ist, wie der Besteller die Äußerungen des Unternehmers unter Berücksichtigung seines sonstigen Verhaltens und der Umstände, die zum Vertragsschluss geführt haben, sowie des bekannten Vertragszwecks nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte verstehen durfte.
2. Ein über eine Beschaffenheitsvereinbarung hinausgehender Garantiewillen bedarf immer einer besonderen Begründung. Mit einer „Garantie“ kann auch nur die gesetzliche Verjährungsfrist verlängert oder das Verschuldenserfordernis zwar nicht ausgeschlossen, aber eine Beweislastumkehr hinsichtlich des Vorliegens eines Mangels und/oder hinsichtlich des Zeitpunkts seines Entstehens vereinbart werden.
3. Beträgt die Gewährleistungsfrist auf konstruktive Teile 30 Jahre, bezieht sie sich lediglich auf solche Bauteile, die statische Relevanz haben, nicht jedoch auf einen Oberputz, Außenputz oder auf Außenfensterbänke.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3054
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.06.2023 - 5 U 116/22
1. Vor Abnahme trägt der Unternehmer die Darlegungs- und Beweislast für die Mangelfreiheit des von ihm herzustellenden Werks. Das Bestehen eines Abrechnungsverhältnisses ändert nichts an dieser Beweislastverteilung.
2. Die Regelung des § 650k Abs. 2 BGB, wonach Zweifel bei der Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unternehmer geschuldeten Leistung zu dessen Lasten gehen, gilt nur für Verbraucherbauverträge.
IBRRS 2024, 3057
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 16.10.2024 - 12 U 6/24
1. Die Voraussetzungen für das Auskunftsverlangen eines Werkunternehmers liegen vor, wenn der Kunde die Mängelbeseitigungsarbeiten, wegen der ihm ein Kostenvorschuss gem. § 637 Abs. 3 BGB zugesprochen worden war, vorgenommen hat.*)
2. Der Vorschuss nach § 637 Abs. 3 BGB ist zweckgebunden und vom Kunden zur Mängelbeseitigung zu verwenden. Der Kunde muss seine Aufwendungen für die Mängelbeseitigung nachweisen, über den erhaltenen Kostenvorschuss Abrechnung erteilen und den für die Mängelbeseitigung nicht in Anspruch genommenen Betrag zurückerstatten. Es entsteht ein Rückzahlungsanspruch des Werkunternehmers in Höhe des nicht zweckentsprechend verbrauchten Vorschusses.*)
3. Dieser Anspruch ist kein Bereicherungsanspruch, sondern ein aus Treu und Glauben entwickelter Anspruch aus dem Vertragsverhältnis. Hat der Kunde die Mängelbeseitigung durchgeführt, so muss er den Vorschuss abrechnen. Ergibt die Abrechnung einen Überschuss für den Werkunternehmer, ist dieser an ihn zurückzuzahlen.*)
4. Der Auskunftsanspruch des Werkunternehmers ist nur dann durch Erfüllung erloschen, § 362 Abs. 1 BGB, wenn der Kunde ‒ um eine Prüfung durch den Werkunternehmer zu ermöglichen ‒ analog § 666 BGB die dortigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Auskunftserteilung erfüllt hat.*)
5. Dazu muss der Kunde den Werkunternehmer über die Einzelheiten der Auftragsausführung in verkehrsüblicher Weise informieren und ihm die Übersicht über das Besorgte verschaffen in einer Weise, die dem Werkunternehmer die Überprüfung der Besorgung gestattet. Es gilt § 259 BGB, so dass erforderlichenfalls genauere Information durch Vorlage einer geordneten Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben geschuldet ist. Die Beweislast für die Richtigkeit der Abrechnung trägt dabei der Kunde, insbesondere für den Verbleib der Einnahmen und dafür, dass er über nicht mehr vorhandene Vermögenswerte gemäß dem Auftrag, nach Weisungen oder im Interesse des Werkunternehmers verfügt hat. Ergänzt mit der Kommentierung zu § 259 BGB erfordert die Rechenschaftslegung eine übersichtliche, in sich verständliche Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben. Die Ausgaben müssen so detailliert und verständlich dargestellt sein, dass der Werkunternehmer ohne fremde Hilfe in der Lage ist, seine Ansprüche und die gegen ihn gerichteten Ansprüche nach Grund und Höhe zu überprüfen. Bei Unvollständigkeit der Rechnung besteht ein Anspruch auf Ergänzung.*)
6. Ist Vortrag des Klägers zum Nachweis der Aktivlegitimation erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden und ist der entsprechende Vortrag gem. § 296a ZPO zurück- und die Klage daraufhin abgewiesen worden, hindern die Verspätungsvorschriften des § 531 ZPO - hier § 531 Abs. 2 ZPO - in der Berufungsinstanz die Berücksichtigung nicht, wenn der Vortrag des Klägers nunmehr unstreitig ist.*)
7. Ohne Antrag auf Zurückverweisung, damit das Landgericht nach weiterem Vortrag der Beklagten die Erfüllung des Auskunftsanspruchs sowie einen möglicherweise daraus resultierenden Rückzahlungsanspruch prüfen kann, kann eine Zurückverweisung analog § 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ZPO nach der Rechtsprechung des II. und VIII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, nicht erfolgen (BGH, Beschluss vom 22.09.2008 - II ZR 257/07, IBRRS 2008, 3249; BGH, Urteil vom 03.05.2006 - VIII ZR 168/05, IBRRS 2006, 1651; a.A. BGH, Urteil vom 21.01.2011 - V ZR 243/09, IBRRS 2011, 0823).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3022
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.04.2021 - 21 U 50/20
1. Haben die Parteien im Zusammenhang mit der Vereinbarung einer 10-jährigen Gewährleistungsfrist geregelt, dass "hierzu [...] eine jährliche Wartung der Flachdächer erforderlich" sei, ist dies nicht dahin auszulegen, dass die vereinbarte Verjährungsfrist an die Beauftragung des Auftragnehmers mit der jährlichen Wartung geknüpft werden sollte.
2. Die Ausweisung einer vom Vertrag abweichenden Verjährungsfrist im Abnahmeprotokoll kann eine einvernehmliche Vertragsänderung beinhalten (hier verneint).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2974
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Karlsruhe, Urteil vom 05.04.2023 - 15 U 101/22
1. Für die Frage, ob eine außerordentliche Kündigung eines Bauvertrags auch als freie Kündigung verstanden werden kann, kommt es maßgeblich darauf an, ob sich aus der Kündigungserklärung ergibt, dass der Bauvertrag unabhängig davon beendet sein soll, ob der geltend gemachte Kündigungsgrund vorliegt.
2. Wird die Kündigung "ausschließlich aus wichtigem Grund" erklärt, gibt der Auftraggeber unmissverständlich zu verstehen, dass die Kündigung nur für den Fall gilt, dass ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung besteht.
3. Der Auftraggeber kann einen Bauvertrag aus wichtigem Grund kündigen, wenn der Auftragnehmer die Vertragserfüllung unberechtigt und endgültig verweigert und es dem Auftraggeber deshalb nicht zugemutet werden kann, das Vertragsverhältnis fortzusetzen.
4. Die unberechtigte Einstellung der Arbeiten zur Durchsetzung eines Nachtrags und die Weigerung, die Leistung binnen einer angemessen gesetzten Frist wieder aufzunehmen, kann eine schwerwiegende Verletzung der bauvertraglichen Kooperationspflicht und damit einen wichtigen Kündigungsgrund darstellen (hier bejaht).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2973
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 03.03.2023 - 21 U 102/21
1. Der Rahmen der vertraglich übernommenen Verpflichtungen steckt bei einem Werkvertrag zugleich den Umfang der Obhuts- und Beratungspflichten ab.
2. Schuldet der mit der Verlegung von Außenwasserleitungen beauftragte Unternehmer nur den Anschluss an einen Übergabepunkt im Außenbereich, hat er nicht für die Mängelfreiheit der Wasserleitungen im Gebäude und via Vorstreckung bis zu diesem Übergabepunkt einzustehen. Ihn trifft keine Vorprüfungspflicht für das Vorgewerk Sanitär im Gebäude und das in den Außenbereich vorgestreckte Rohr (hier: Einholung von Druckprüfungsprotokollen).
3. Dem Architekten obliegt es in der Leistungsphase 8, die an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten zu koordinieren. Dieser Ausschnitt der allgemeinen Koordinierungspflicht des umfassend beauftragten Architekten erfasst alle von der Bauausführung betroffenen Leistungsbereiche, auch derjenigen, für die besondere Fachbauleiter eingesetzt sind.
4. Der Architekt haftet nicht für Bereiche, die dem Sonderfachmann in Auftrag gegeben wurden und wenn die konkrete fachspezifische Frage nicht zum Wissensbereich des Architekten gehört. Denn der Umfang und die Intensität der Überwachungstätigkeit hängen von den konkreten Anforderungen der Baumaßnahme und den jeweiligen Umständen ab.
5. Der Architekt genügt seiner Koordinierungspflicht, wenn er unter Einbeziehung des eingeschalteten Außenanlagenplaners die Übergabepunkte am vorgestreckten Rohr im Außenbereich festlegt.
IBRRS 2024, 2972
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 18.01.2022 - 21 U 1005/20
1. Mit einer hinreichend genauen Bezeichnung der "Mangelerscheinungen" (der "Symptome" des Mangels) kann der Mangel selbst bezeichnet und damit Gegenstand der jeweiligen Vertragserklärungen werden, während der Auftraggeber den Mangel selbst, also die wirklichen Ursachen der Symptome, nicht zu bezeichnen braucht.
2. Es ist unschädlich, wenn der Auftraggeber zusätzlich solche Mangelursachen bezeichnet. Das gilt auch, wenn er insoweit Gutachten übermittelt, in denen bestimmte Aussagen über die Ursachen gemacht werden. Damit werden Rechtswirkungen oder das weitere Vorgehen nicht auf die bezeichneten oder vermuteten Ursachen beschränkt. Vielmehr sind auch dann immer alle Ursachen für die bezeichneten Symptome von seinen jeweiligen Erklärungen erfasst. Das gilt auch dann, wenn die angegebenen Symptome des Mangels nur an einigen Stellen aufgetreten sind, während ihre Ursache und damit der Mangel des Werkes in Wahrheit das ganze Gebäude erfasst.
3. Zur Herbeiführung einer Verjährungshemmung muss der Mangel nur hinreichend bezeichnet worden sein; inwieweit er bereits durch Privatgutachten etc. über das erforderliche Mindestmaß des Vortrags weiter substantiiert bzw. bereits "anbewiesen" ist, ist unerheblich.
4. Eine Anrechnung "neu für alt" kommt jedenfalls dann nicht in Betracht kommt, wenn die Vorteile ausschließlich auf einer Verzögerung der Mängelbeseitigung beruhen und sich der Auftraggeber jahrelang mit einem fehlerhaften Werk begnügen musste.
5. Der Lauf der Verjährungsfrist für einen Anspruch auf Bürgschaftsherausgabe beginnt nicht vor Ende des Jahres, in dem der von der Bürgschaft gesicherte Gewährleistungsanspruch entstanden ist. Das ist anzunehmen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des auf Geld gerichteten Gewährleistungsanspruchs vom Auftraggeber geschaffen wurden.
6. Bei der Verjährung kann eine vertragliche Vereinbarung zu berücksichtigen sein, nach der die Dauer der Bürgschaftshingabe insoweit an die Dauer der Gewährleistungsfrist der Käufer gekoppelt sein sollte, als die Dauer der Hingabe einen Monat nach Ablauf der Gewährleistungsfrist überschreiten sollte ("Gleichlaufabrede").
IBRRS 2024, 2957
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 05.09.2024 - 12 U 3/22
1. Wird eine bestimmte Leistung bereits nach dem Ursprungsvertrag geschuldet und bezahlt, kann der Auftragnehmer dieselbe Leistung in der Regel nicht ein zweites Mal aufgrund einer Nachtragsvereinbarung bezahlt verlangen. Dafür wäre erforderlich, dass sich der Auftraggeber in vertragsändernder Weise oder durch Anerkenntnis oder Vergleich eindeutig damit einverstanden erklärt, eine zusätzliche Vergütung ohne Rücksicht auf die schon bestehenden Leistungspflichten des Auftragnehmers zu zahlen.
2. Erklärt der Auftraggeber in einem Abnahmeprotokoll die Abnahme "beschränkt [...] auf folgende Teilleistungen", liegt darin keine Teilabnahme, sondern eine Gesamtabnahme unter Vorbehalt der Rechte bezüglich der benannten Mängel.
3. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber sich die Ansprüche bezüglich des konkreten Mangels nicht bei der Abnahme vorbehält.
4. Der Umstand, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach Ablauf der Nachbesserungsfrist die Nachbesserung untersagt hat, berührt die Gewährleistungsansprüche nicht. Nach Fristablauf ist der Auftragnehmer gehindert, ohne Zustimmung des Auftraggebers nachzubessern.
5. Der Auftragnehmer kann sich gegenüber einem nicht fachkundigen Auftraggeber später nicht darauf berufen, die ihm gesetzte Frist sei zu kurz gewesen, wenn er dies nicht unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat und eine solche Rüge zu erwarten war, weil der Auftraggeber der vertretbaren Auffassung sein durfte, die Frist sei angemessen.
6. Der Auftraggeber darf bei der Ersatzvornahme darauf vertrauen, dass der Drittunternehmer die Mängelbeseitigung zu angemessenen Preisen durchführen wird. Bei der Würdigung, welche Maßnahme zu welchen Preisen möglich und zumutbar war, ist zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber nicht gehalten ist, im Interesse des säumigen und nachbesserungsunwilligen Unternehmers besondere Anstrengungen zu unternehmen, um den preisgünstigsten Drittunternehmer zu finden.
IBRRS 2024, 2948
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Münster, Urteil vom 23.05.2024 - 12 O 204/23
1. Die Baustelleneinrichtung umfasst z. B. die Lagerung von Geräten und Maschinen, das Aufstellen von Containern zur Unterbringung von Arbeitskräften, witterungsempfindlichen Bau- und Bauhilfsstoffen, Ersatzteilen und Ähnlichem sowie Lager- und Verkehrsflächen.
2. Nicht zur Baustelleneinrichtung gehören die Bauarbeiten als solche, das heißt auch nicht die Erstellung von Brunnen, Bohrungen oder Leitungsverlegung zur Wasserhaltung.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2932
 Prozessuales
Prozessuales
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 08.01.2024 - 2-31 O 6/23
1. Macht der Auftraggeber widerklagend eine Überzahlung geltend, führt das Anerkenntnis dieses Anspruchs durch den Auftragnehmer nicht schon deshalb zu einer Abweisung der Restvergütungsklage des Auftragnehmers, weil die Überzahlung denklogisch ausschließe, dass der Auftragnehmer weitere Zahlungen an sich verlangen könne.
2. Ein prozessuales Anerkenntnis gegenüber einer (verspäteten) Widerklage mit dem Ziel, die Präklusion der Klageerwiderung zu bewirken, ist möglich. Eine Partei, die bewusst in die Widerklage "flieht", um die Präklusion zu umgehen, ist nicht schutzwürdig.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2928
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 25.06.2024 - 5 U 38/23
1. Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung liegt beim Einbau einer Küche für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eines neu errichteten Wohnhauses ein Bauvertrag vor.
2. Eine formularmäßige Skontoklausel, nach der der gesamte Zahlbetrag "fällig bis zum Tage der Lieferung und Rechnungsstellung" sein soll, ist wegen unzulässiger Einschränkung des Zurückbehaltungsrechts des Kunden unwirksam.
3. Erklärt eine Skontoklausel die Rechnungsstellung als maßgeblich für die Fälligkeit, benachteiligt dies den Kunden ebenfalls unangemessen.
4. Die zeitliche Einschränkung der Zahlung "am Tage der Lieferung und Rechnungsstellung" benachteiligt den Kunden unangemessen, da hierdurch die Notwendigkeit einer Mahnung entfällt. Dies gilt unabhängig davon, dass eine Bar- oder Sofortzahlung dem Kunden auch nicht zumutbar ist, wobei sich die faktische Einschränkung der Zahlungsmethode sowohl als eine unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 Abs. 1 BGB darstellt als auch - selbst bei Individualabreden - nach § 312a Abs. 4 Nr. 1 BGB unwirksam ist.
5. Die Vereinbarung der Zahlung eines "Skontobetrags", der mehr als 20% des "Küchengesamtpreises" ausmacht, ist als Vertragsstrafe zu werten und aufgrund dieses Umfangs unwirksam.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2911
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Kempten, Urteil vom 27.09.2024 - 11 O 1705/23 Bau
1. Anordnungen zur Bauzeit sind keine Änderungen des Bauentwurfs i.S.v. § 1 Abs. 3 VOB/B. Denn der Bauentwurf beschreibt die erfolgsorientierte Komponente des Werkvertrags. Die Bauzeit gehört nicht dazu.
2. Anordnungen zur Bauzeit sind auch keine "anderen Anordnungen" i.S.v. § 2 Abs. 5 VOB/B (entgegen KG, IBR 2024, 504). Derartige andere Anordnungen setzen eine gesonderte Vereinbarung voraus.
3. Der Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren. Sie beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Der Anspruch aus § 642 BGB entsteht grundsätzlich mit Abschluss des Jahres, in dem die jeweiligen Kosten angefallen sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2886
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 22.08.2024 - VII ZR 68/22
Die Minderung des Vergütungsanspruchs nach § 634 Nr. 3 Fall 2, § 638 BGB schließt einen Kostenvorschussanspruch nach § 634 Nr. 2, § 637 Abs. 3 BGB wegen des Mangels, auf den die Minderung gestützt wird, nicht aus.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2850
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 15.08.2024 - 10 U 100/23
1. Enthält ein Angebot zum Abschluss eines Bauvertrags die Bedingung, dass ihm "die VOB neuester Fassung" zu Grunde liegt, ist dies weder intransparent noch überraschend, sondern führt zur wirksamen Einbeziehung der VOB/B in der bei Vertragsschluss aktuellen Fassung, wenn der Auftraggeber bei Vertragsschluss durch einen Architekten vertreten wird.
2. Da mit der vereinbarten Vergütung alle Leistungen abgegolten sind, die nach der Baubeschreibung der Leistung innerhalb des Bauvertrags zur vertraglichen Leistung gehören, muss für eine zusätzliche Vergütung eine vom Auftraggeber veranlasste Leistungsänderung vorliegen. Maßgeblich ist die Bestimmung der vertraglichen Verpflichtung des Auftragnehmers, somit die Ermittlung des Bau-Solls, im Vergleich zu der (behaupteten) Änderung. Unklarheiten gehen zu Lasten des insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Auftragnehmers.
3. Legt der Auftragnehmer ein Nachtragsangebot vor und fordert der Architekt des Auftraggebers diesen daraufhin zur Leistungserbringung auf, liegt darin nicht ohne Weiteres eine Beauftragung im Sinne einer einvernehmliche Vertragsänderung.
4. Der Auftraggeber ist nach erfolglosem Ablauf der dem Auftragnehmer gesetzten Mängelbeseitigungsfrist nicht mehr verpflichtet, die angebotene Mängelbeseitigung anzunehmen oder ihm nochmals eine Frist zur Nacherfüllung einzuräumen, denn das Recht (nicht die Pflicht) zur Nacherfüllung des Auftragnehmers erlischt, wenn der Auftraggeber ihm eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat
5. Mängel stehen einer konkludenten Abnahme nur dann entgegen, wenn sie den Vertragsparteien bekannt bzw. durch den Auftraggeber gerügt sind.
6. Die Abnahmefiktion nach § 12 Abs. 5 VOB/B hält jedenfalls bei Verbraucherverträgen der Inhaltskontrolle nicht stand. Die Vertretung durch einen Architekten bei Vertragsschluss ändert nichts an der Verbrauchereigenschaft.
7. Nach § 213 BGB gilt die Verjährungshemmung auch für Ansprüche, die aus demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind. Alle Gewährleistungsansprüche, die auf demselben Mangel beruhen, sind als solche aus demselben Grund anzusehen. Die Hemmung eines von ihnen erstreckt sich demnach auch auf die anderen Gewährleistungsansprüche und zwar unabhängig davon, in welcher Höhe sie geltend gemacht werden.
IBRRS 2024, 2847
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 25.07.2024 - VII ZR 646/21
Die durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 22.08.2013 (IBR 2014, 49) veranlasste ergänzende Vertragsauslegung im Verhältnis des leistenden Bauunternehmers zum Leistungsempfänger (Bauträger) wird nicht dadurch beeinflusst, dass es - etwa wegen eingetretener Festsetzungsverjährung - nicht mehr zu einer Steuerfestsetzung kommen wird und der Bauunternehmer daher keine Umsatzsteuer mehr an den Fiskus abführen muss.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2699
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 10.07.2024 - 12 U 80/22
1. Ein nach allgemeinem Leistungsstörungsrecht bestehender Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung, der auf den Ersatz von Mangelfolgeschäden gerichtet ist, kann schon vor der Abnahme geltend gemacht werden.
2. Ein Werk ist auch dann mangelhaft, wenn es die vereinbarte oder nach dem Vertrag vorausgesetzte Funktion nur deshalb nicht erfüllt, weil die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Leistungen anderer Unternehmer, von denen die Funktionsfähigkeit des Werks abhängt, unzureichend sind.
3. Der Unternehmer ist dann nicht für den Mangel seines Werks verantwortlich, wenn dieser auf Vorleistungen anderer Unternehmer zurückzuführen ist und der Unternehmer seine Prüf- und Hinweispflicht erfüllt hat.
4. Der Rahmen der Prüf- und Hinweispflicht und ihre Grenzen ergeben sich aus dem Grundsatz der Zumutbarkeit, wie sie sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalls darstellt. Was hiernach zu fordern ist, bestimmt sich in erster Linie durch das vom Unternehmer zu erwartende Fachwissen und durch alle Umstände, die für den Unternehmer bei hinreichend sorgfältiger Prüfung als bedeutsam erkennbar sind.
5. Der Auftraggeber schuldet dem Unternehmer grundsätzlich keine Bauaufsicht und muss sich daher ein Überwachungsverschulden der von ihm eingesetzten Bauleitung nicht anspruchsmindernd als Mitverschulden zurechnen lassen.
6. Auch mangelhafte Leistungen des Vorunternehmers sind dem Auftraggeber regelmäßig nicht im Wege des Mitverschuldens zuzurechnen, weil der Vorunternehmer nicht als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers einzustufen ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2738
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.07.2021 - 23 U 108/20
1. Ein bloßer Hinweis auf die VOB/B reicht bei privaten Bauherren für deren Einbeziehung nicht ohne Weiteres aus.
2. Trotz des funktionalen Mangelbegriffs liegt kein Mangel des Werks vor, wenn dem Besteller die Funktionseinschränkung der vereinbarten Ausführung des Werks bekannt ist und er sich in Kenntnis der Funktionseinschränkung eigenverantwortlich dennoch für diese Ausführung entschieden hat.
3. Eine solche konkludente Risikoübernahme setzt grundsätzlich voraus, dass der Unternehmer den Besteller über das bestehende Risiko aufgeklärt und der Besteller sich rechtsgeschäftlich mit der Risikoübernahme einverstanden erklärt hat. Sie kann entbehrlich sein, wenn der Besteller sich des übernommenen Risikos und seiner Tragweite ohnehin bewusst ist.
4. Beauftragt der Besteller einen Sachverständigen mit der Prüfung und Begutachtung etwaiger Mängel, sind die entstehenden Kosten ersatzfähig, wenn der Besteller diese Aufwendungen für erforderlich halten durfte bzw. der Auftrag auch zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war. Dabei sind Privatgutachterkosten grundsätzlich auch dann vom Unternehmer zu erstatten, wenn das Gutachten teilweise unzutreffende Feststellungen enthält.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2720
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 27.08.2024 - 21 U 128/23
1. Ordnet der Besteller eines VOB-Vertrags gegenüber dem Unternehmer an, seine Leistung vollständig oder in Teilen nicht zur vertraglich vorgesehenen Zeit, sondern später zu erbringen, und ist dem Besteller dabei erkennbar, dass dem Unternehmer dadurch Mehrkosten entstehen können, so liegt hierin eine "andere Anordnung" im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B, die eine Mehrvergütung zugunsten des Unternehmers auslösen kann.*)
2. Dies kann grundsätzlich auch dann gelten, wenn sich die Anordnung der Zeitverschiebung nicht auf den Zeitpunkt der Leistung selbst, sondern auf Vorbereitungshandlungen bezieht.*)
3. Grundlage des Mehrvergütungsanspruchs aus § 2 Abs. 5 VOB/B sind die Mehr- oder Minderkosten M, die dem Unternehmer durch die Anordnung des Bestellers tatsächlich entstanden sind.*)
4. Im Fall der zeitlichen Verschiebung der Ausführungszeit durch Anordnung gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B ergibt sich M als die Differenz zwischen den Kosten, die die Klägerin aufgrund der Verschiebung tatsächlich aufwenden musste (Kosten neu = Kosten N) und denjenigen, die ihr ohne die Verschiebung entstanden wären (Kosten alt = Kosten A).*)
5. Hingegen kann die Mehrvergütung nicht unter Außerachtlassung der Kosten A allein auf Grundlage der tatsächlichen Kosten N zuzüglich eines angemessenen Zuschlags ermittelt werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2702
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 11.07.2024 - VII ZR 127/23
1. Fordert der Besteller eine Werklohnvorauszahlung zurück, nachdem der Unternehmer Leistungen erbracht hat, muss der Besteller schlüssig die Voraussetzungen eines Saldoüberschusses aus einer Schlussabrechnung vortragen. Ausreichend ist eine Abrechnung, aus der sich ergibt, in welcher Höhe der Besteller Voraus- und Abschlagszahlungen geleistet hat und dass diesen Zahlungen ein entsprechender endgültiger Vergütungsanspruch des Unternehmers nicht gegenübersteht. Der Besteller kann sich auf den Vortrag beschränken, der bei zumutbarer Ausschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden Quellen seinem Kenntnisstand entspricht. Hat der Besteller nach diesen Grundsätzen ausreichend vorgetragen, muss der Unternehmer darlegen und beweisen, dass er berechtigt ist, die Voraus- und Abschlagszahlungen endgültig zu behalten (Bestätigung von BGH, Urteil vom 11.02.1999 - VII ZR 399/97, IBRRS 2024, 2702; Urteil vom 24.01.2002 - VII ZR 196/00, IBR 2002, 235; Urteil vom 22.11.2007 - VII ZR 130/06, IBR 2008, 98).*)
2. Welcher Vortrag vom Besteller im Fall der Abrechnung eines gekündigten Pauschalpreisvertrags ohne Detailpreisverzeichnis unter zumutbarer Ausschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden Quellen verlangt werden kann, um eine Werklohnvorauszahlung zurückzufordern, richtet sich nach den Gesamtumständen, insbesondere nach dem Inhalt des Vertrags und vorvertraglicher Absprachen. Kennt der Besteller die Kalkulation des Unternehmers nicht und kann er nicht aufgrund anderer Umstände das vertragliche Preisniveau darstellen, obliegt dem Unternehmer insoweit die Darlegungslast.*)
3. Diese Darlegungslastverteilung gilt in einem Rechtsstreit zwischen dem Besteller und einem Bürgen, der sich verpflichtet hat, für einen Anspruch auf Rückzahlung der Werklohnvorauszahlung einzustehen, entsprechend. Der Bürge kann den Besteller nicht darauf verweisen, entsprechende Informationen beim Unternehmer einzufordern.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2680
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 25.07.2024 - VII ZR 84/21
Die durch das Urteil des BFH vom 22.08.2013 (IBR 2014, 49) veranlasste ergänzende Vertragsauslegung im Verhältnis des leistenden Bauunternehmers zum Leistungsempfänger (Bauträger) wird nicht dadurch beeinflusst, dass es - etwa wegen eingetretener Festsetzungsverjährung - nicht mehr zu einer Steuerfestsetzung kommen wird und der Bauunternehmer daher keine Umsatzsteuer mehr an den Fiskus abführen muss.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2675
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 02.11.2021 - 11 U 28/21
1. Ein Bauvertrag ist (wegen Wuchers) nichtig, wenn ein objektiv auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht und subjektive Umstände wie die vorwerfbare Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche des Benachteiligten hinzutreten.
2. Die Vollkaufmann-Eigenschaft des Benachteiligten begründet die widerlegliche Vermutung, dass der Begünstigte nicht in verwerflicher Weise eine persönliche oder geschäftliche Unterlegenheit des Benachteiligten ausgenutzt hat.
3. Die Abnahme des Werks kann auch durch einen Dritten erfolgen, wenn der Besteller diese gegen sich gelten lassen will.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2400
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 14.03.2022 - 11 U 28/21
1. Ein Bauvertrag ist (wegen Wuchers) nichtig, wenn ein objektiv auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht und subjektive Umstände wie die vorwerfbare Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche des Benachteiligten hinzutreten.
2. Die Vollkaufmann-Eigenschaft des Benachteiligten begründet die widerlegliche Vermutung, dass der Begünstigte nicht in verwerflicher Weise eine persönliche oder geschäftliche Unterlegenheit des Benachteiligten ausgenutzt hat.
3. Die Abnahme des Werks kann auch durch einen Dritten erfolgen, wenn der Besteller diese gegen sich gelten lassen will.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2592
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 08.03.2023 - 17 U 70/22
1. Der Unternehmer kann eine Sicherheit nach § 648a Abs. 1 BGB a.F. unabhängig davon verlangen, ob Ansprüche auf Vergütung oder Abschlagszahlung fällig sind.
2. Das Sicherungsverlangen ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Dass mit dem Sicherungsverlangen nicht zugleich die Kostenübernahme angeboten wird, ist ebenso unschädlich wie der Umstand, dass die Art der Sicherheit offengelassen wird.
3. Ein überhöhtes Sicherheitsverlangen begründet nicht dessen Unwirksamkeit. Vielmehr ist es dann grundsätzlich am Besteller, eine angemessene Sicherheit zu leisten.
4. Ein Sicherungsverlangen nach § 648a BGB a.F. ist nicht wegen Übersicherung oder nach § 242 BGB unwirksam, wenn der Unternehmer zuvor im Wege der einstweiligen Verfügung die Eintragung einer Sicherungshypothek nach § 648 BGB a.F. erwirkt hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Hypothek vollwertig ist.
5. Im Regelfall ist eine Frist zur Sicherheitsleistung von 7 bis 10 Kalendertagen als angemessen anzusehen. Eine unangemessene Fristsetzung würde nicht zur Unwirksamkeit des Sicherungsverlangens führen, sondern lediglich eine angemessene Frist in Gang setzen.
6. Verhandlungen über die Art und Höhe einer zu leistenden Sicherheit oder alternativ zu einer einvernehmlichen Vertragsaufhebung führen weder zur Hemmung der gesetzten Frist noch begründen sie eine Pflicht, die Verhandlungen eindeutig abzubrechen und eine neue Frist zu setzen. Der Unternehmer muss weder ankündigen noch androhen, ob er von seinen Rechten im Falle einer Nichtleistung der Sicherheit Gebrauch macht.
7. Eine weitere Fristsetzung ist auch dann nicht erforderlich, wenn der Unternehmer zunächst die weitere Leistungserbringung verweigert. Er ist ohne weitere Fristsetzung berechtigt, anschließend die Kündigung auszusprechen.
8. Die eigene Vertragstreue ist kein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal für das Recht auf Sicherheit gemäß § 648a BGB a.F.
9. Es stellt keine unzulässige Rechtsausübung und auch keinen Verstoß gegen das bauvertragliche Kooperationsgebot dar, wenn dem Sicherungsverlangen des Unternehmers auch andere Motive als die bloße Erlangung einer Sicherheit zugrunde liegen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2619
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 03.07.2024 - 12 U 63/22
1. Bei einer Dusche in einer Nische ist die Breite von erheblicher Bedeutung für die Benutzung. Eine Abweichung zwischen Planung (87 cm lichte Breite) und Ausführung (79,4 cm lichte Breite) von ca. 10% stellt sich als so erheblich dar, dass sie nicht mehr im Rahmen bauüblicher Toleranzen liegt.
2. Der Unternehmer kann die Mängelbeseitigung wegen Unverhältnismäßigkeit verweigern, wenn nach den Umständen des Einzelfalls ein objektiv geringes Interesse des Bestellers an einer mangelfreien Werkleistung einem ganz erheblichen und vergleichsweise unangemessenen Kostenaufwand gegenübersteht (hier bejaht für die Ausführung eines Drempels in 1,57 m Höhe statt der vereinbarten 1,70 m Höhe).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2508
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Stuttgart, Urteil vom 18.09.2023 - 10 U 15/23
1. Wird der Auftragnehmer mit der Herstellung des Kanalanschlusses, der Versorgungsanschlüsse, des Revisionsschachts sowie der zugehörigen Erdarbeiten beauftragt, umfasst seine werkvertragliche Herstellungspflicht den Bau einer durchgehenden, funktionstüchtigen Grundleitung von der Hausaußenkante bis zum öffentlichen Abwasserkanal und zwar ohne Unterscheidung, von welchen weiteren Nutzern das Abwasserrohr oder Teilstrecken davon noch benutzt wird.
2. Die Funktionsfähigkeit kann schon dann beeinträchtigt und das Werk mangelhaft sein, wenn das Risiko eines Gefahreintritts besteht. Der Auftragnehmer muss daher eine Grundleitung, die ausschließlich für das Nachbargebäude angelegt wird, so errichten, dass Gefahren aus dieser Leitung für die Entwässerung des Auftraggebers ausgeschlossen werden.
3. Das Gericht darf und muss sich nach § 286 ZPO für die Gewinnung der vollen Überzeugung von der Wahrheit behaupteter Tatsachen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen. Eine mathematische, jede Möglichkeit eines abweichenden Geschehensablaufs ausschließende, von niemandem mehr anzweifelbare Gewissheit ist nicht erforderlich. Rein theoretische und lediglich spekulative Möglichkeiten können für die Überzeugungsbildung keine maßgebliche Bedeutung haben.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2436
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 28.02.2023 - 27 U 128/21
1. Der Auftraggeber ist auch nach einer Teilkündigung berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Leistung bzw. die Mängel zu Lasten des Auftragnehmers durch Dritte ausführen zu lassen. Er hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche spätestens 12 Werktage nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.
2. Die vereinbarte Vergütung wird infolge einer Mangelhaftigkeit nicht automatisch im Umfang der Wertminderung herabgesetzt. Auch eine mangelhafte Werkleistung ist erbracht und damit nach Fälligkeitseintritt zunächst voll vergütungspflichtig.
3. Rechnet der Auftragnehmer zusätzliche Leistungen im Stundenlohn ab, hat er nicht nur darzulegen, wann der Auftraggeber bzw. wann welcher bevollmächtigte Mitarbeiter des Auftraggebers welche Arbeiten insoweit in Auftrag gegeben hat, sondern auch, dass es sich nicht um Arbeiten gehandelt hat, die bereits nach dem Werkvertrag geschuldet waren oder bei denen es sich schlicht um Mängelbeseitigungsarbeiten gehandelt hat.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2515
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Beschluss vom 24.05.2022 - 14 U 27/22
1. Macht der Auftraggeber wegen eines gestörten Bauablaufs eine Entschädigung gem. § 642 BGB geltend, hat der unter anderem eine konkrete, bauablaufbezogene Darstellung unter Berücksichtigung von Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen.
2. Darzulegen ist vom Auftragnehmer dabei, wie er den Bauablauf tatsächlich geplant hatte, das heißt, welche Teilleistungen er in welcher Zeit erstellen wollte und wie der Arbeitskräfteeinsatz erfolgen sollte. Dem ist der tatsächliche Bauablauf gegenüberzustellen.
3. Darzulegen sind auch etwaige Möglichkeiten, andere Bauabschnitte vorzuziehen oder Arbeitskräfte anderweitig einzusetzen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2514
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Beschluss vom 24.06.2022 - 14 U 27/22
1. Macht der Auftraggeber wegen eines gestörten Bauablaufs eine Entschädigung gem. § 642 BGB geltend, hat er u. a. eine konkrete, bauablaufbezogene Darstellung unter Berücksichtigung von Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen.
2. Darzulegen ist vom Auftragnehmer dabei, wie er den Bauablauf tatsächlich geplant hatte, d. h. welche Teilleistungen er in welcher Zeit erstellen wollte und wie der Arbeitskräfteeinsatz erfolgen sollte. Dem ist der tatsächliche Bauablauf gegenüberzustellen.
3. Darzulegen sind auch etwaige Möglichkeiten, andere Bauabschnitte vorzuziehen oder Arbeitskräfte anderweitig einzusetzen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2441
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.02.2024 - 22 U 98/23
1. Im VOB/B-Vertrag sind für die Bemessung eines neuen Einheitspreises bei geänderten und zusätzlichen Leistungen i.S.v. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge maßgeblich.
2. Eine vom Auftraggeber vorformulierte Vertragsklausel, wonach der Auftraggeber den Bauvertrag wegen Mängeln vor der Abnahme kündigen kann, ohne dass es einer Kündigungsandrohung bedarf, benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen und ist unwirksam.
3. Die Abnahme ist keine Voraussetzung für einen Vorschussanspruch wegen Mängeln, wenn ein Abrechnungsverhältnis eingetreten ist.
4. Angemessen ist eine Frist zur Mängelbeseitigung, innerhalb derer der Auftragnehmer unter größten Anstrengungen in der Lage ist, die Mängel zu beseitigen. Eine zu kurze Frist ist nicht wirkungslos, sondern führt zum Lauf einer angemessenen Frist.
5. Der Auftragnehmer kann einen gerügten Mangel grundsätzlich nicht mit Nichtwissen bestreiten. Anders ist es, wenn der Auftraggeber es dem Auftragnehmer unmöglich gemacht hat, den Mangel zu besichtigen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2439
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.07.2024 - 22 U 98/23
1. Führt der Auftragnehmer auf Anordnung des Auftraggebers geänderte oder zusätzliche Leistungen aus, liegt in der Regel (nur) eine Erweiterung des bisherigen Auftrags vor. Dann richtet sich die Vergütung nach dem vereinbarten Preisgefüge.
2. Nur dann, wenn die Parteien eines Werk- oder Bauvertrags einen gänzlich neuen Vertrag (sog. Anschluss- oder Folgeauftrag) schließen, ohne eine Einigung über die Höhe des Werklohns getroffen zu haben, ist die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2433
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Oldenburg, Urteil vom 08.11.2022 - 2 U 10/22
1. Werden zeichnerische und rechnerische Unterlagen Vertragsbestandteil, die Widersprüche zum - ebenfalls Vertragsinhalt gewordenen - Angebot des Unternehmers aufweisen, geht das zeitlich nachfolgende, konkrete Angebot den Plänen im Rahmen der Auslegung des Vertrags vor.
2. Eine konkludente Abnahme setzt ein Verhalten des Auftraggebers bzw. seines Bevollmächtigten voraus, dem zu entnehmen ist, dass er die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht billigt. Dies kann überhaupt nur in Betracht kommen, wenn das Werk im Wesentlichen mangelfrei fertig gestellt ist.
3. Eine Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung kommt nur in Betracht, wenn die Abwägung aller Umstände des Einzelfalls ergibt, dass der durch die Mängelbeseitigung erzielbare Erfolg zu dem durch sie verursachten Geldaufwand außer Verhältnis steht. Sie ist regelmäßig nur dann gerechtfertigt, wenn einem objektiv geringem Interesse des Auftraggebers an der mangelfreien Leistung ein ganz erheblicher und damit unangemessener Aufwand gegenübersteht, so dass die Forderung nach der vertragsgemäßen Leistung letztlich gegen Treu und Glauben verstieße.
4. Von einer Anscheinsvollmacht ist auszugehen, wenn der Auftraggeber dem Architekten allein die Vertragsverhandlungen mit dem Unternehmer überlässt, dieser bereits den Vertrag verhandelt und unterzeichnet hat oder in anderer Weise dem Architekten völlig freie Hand bei der Durchführung des Bauvorhabens lässt, ohne sich selbst um den Bau zu kümmern (beides hier bejaht).
5. Umfang und Intensität der von einem Architekten geschuldeten Überwachung hängen von den Anforderungen der Baumaßnahme sowie den konkreten Umständen ab. Einfache Arbeiten bedürfen keiner Überwachung, während der Architekt kritischeren und wichtigeren Bauabschnitten eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken muss. Erst recht sind an die Überwachungspflicht des Architekten höhere Anforderungen zu stellen, wenn sich im Verlaufe der Bauausführung Anhaltspunkte für Mängel zeigen.
6. Die Überwachung von Wärmedämmarbeiten unterliegt höheren Anforderungen, denen der Architekt nicht gerecht wird, wenn er lediglich Stichproben durchführt.
7. Der durch den überwachenden Architekten geschuldete Werkerfolg besteht u. a. darin, ein den Leistungszielen des Auftraggebers und damit der (auch mit den Unternehmern vereinbarten Beschaffenheit, im Übrigen der üblichen Beschaffenheit und damit auch den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechendes, funktionierendes Bauwerk entstehen zu lassen. Verkörpert sich im Bauwerk infolge der unzureichenden Überwachung ein davon abweichendes Ergebnis handelt es sich um einen ohne Fristsetzung zu erstattenden Mangelfolgeschaden.
IBRRS 2024, 2432
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Oldenburg, Urteil vom 12.07.2022 - 2 U 247/21
1. Der Auftraggeber eines VOB/B-Vertrags kann nach Kündigung des Bauvertrags wegen Mängeln einen Vorschuss für die zu erwartenden Mängelbeseitigungskosten verlangen. Ein solcher Anspruch besteht nicht, soweit der Auftraggeber den Werklohn einbehalten kann.
2. Die Abrechnung eines Pauschalvertrags nach einer Kündigung muss dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Auftragnehmer keine ungerechtfertigten Vorteile aus einer Kündigung ziehen darf. Der Auftraggeber schuldet eine Vergütung, die dem am Vertragspreis orientierten Wert der erbrachten Leistung im Zeitpunkt der Kündigung entspricht (BGH, IBR 1995, 455). Insoweit ist nach der Vergütung für die erbrachten Leistungen einerseits und den derjenigen für die nicht erbrachten Leistungen zu differenzieren.
3. Die Grundsätze über die Abrechnung eines gekündigten Pauschalvertrags gelten nicht nur für die Prüfbarkeit der Abrechnung im Sinne einer Fälligkeitsvoraussetzung, sondern auch für die Beurteilung der Schlüssigkeit der Vergütungsklage.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2422
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 05.07.2024 - 12 U 95/22
1. Ordnet der Auftraggeber nachträglich den Wegfall einzelner Leistungen eines Einheitspreisvertrages an und kommen diese Leistungen dann letztlich einvernehmlich nicht zur Ausführung, liegt kein der Äquivalenzstörung durch Mengenminderung i.S.d. § 2 VOB/B entsprechender Sachverhalt vor. Für die Abrechnung der nicht unter § 2 VOB/B fallenden Nullpositionen kommt dann nur eine Abrechnung nach § 8 VOB/B bzw. § 648 BGB (analog) in Betracht (Anschluss an OLG München, IBR 2019, 307), sofern sich die Parteien nicht anderweitig geeinigt haben.*)
2. Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der die Vertragsstrafe für die Überschreitung der Frist für die Vollendung auf insgesamt 5% der vor der Ausführung des Auftrags vereinbarten Nettoauftragssumme begrenzt ist, beeinträchtigt bei einem Einheitspreisvertrag den Auftragnehmer als Vertragspartner des Verwenders nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen (Anschluss an BGH, IBR 2024, 227).*)
3. Dies gilt auch dann, wenn unklar bleibt, ob mit der Klausel auf die Nettoangebotssumme oder die korrekte Nettoschlussrechnungssumme Bezug genommen wird. Diese Unklarheit geht gem. § 305c Abs. 2 BGB bei der Auslegung zu Lasten des Verwenders.*)
4. Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die als Sicherungsvereinbarung einen Einbehalt von 5% der Auftragssumme vorsieht, ohne den Zeitraum für den Einbehalt zu regeln, benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen, weil sie es dem Auftraggeber ermöglicht, die Bürgschaft nach seinem Belieben zu befristen (Anschluss an BGH, IBR 2003, 476; OLG Köln, IBR 2012, 454).*)
5. Ob Skonto nur für die Schlusszahlung oder auch für Abschlagszahlungen vereinbart ist, muss durch Auslegung des Vertrags ermittelt werden. Die Auslegung einer Skontovereinbarung kann ergeben, dass Skonto auch dann auf eine innerhalb der Skontofrist geleistete Abschlagszahlung zu gewähren ist, wenn zwar nicht die gesamte Summe der berechtigten Abschlagsrechnung bezahlt wird, jedoch ein nicht unerheblicher Teil der berechtigten mit einer Abschlagsrechnung begehrten Forderung.*)
6. Der Auftraggeber einer Werkleistung ist bei Leistung von Abschlags- oder Vorauszahlungen auf den Werklohn innerhalb einer eingeräumten Skontierungsfrist nach dem Sinn und Zweck der Skontoabrede auch dann zum Skontoabzug hinsichtlich des geleisteten Betrags berechtigt, wenn er die Schlussrechnung selbst nicht vollständig oder verspätet bezahlt (Fortführung OLG Hamm, Urteil vom 12.01.1994 - 12 U 66/93, IBRRS 1994, 0714; Anschluss an OLG Köln, Urteil vom 30.01.1990 - 22 U 181/89, IBRRS 1990, 0848).*)
7. Rechnet der Kläger mit (einem Teil) der ihm zuerkannten Klageforderung gegen eine anderweitige Gegenforderung des Beklagten auf, so erstreckt sich die Rechtskraftwirkung des Urteils, das die Klage mit Rücksicht auf die Aufrechnung (teilweise) abweist, nicht in entsprechender Anwendung des § 322 Abs. 2 ZPO auf die Gegenforderung (Anschluss an BGH, Urteil vom 04.12.1991 - VIII ZR 32/91, IBRRS 1991, 0371).*)
IBRRS 2024, 2378
 Bauhaftung
Bauhaftung
KG, Urteil vom 30.06.2023 - 7 U 94/21
1. Die Versicherung kann beim versicherten Auftragnehmer Regress nehmen, wenn der Versicherungsvertrag Ausnahmen von einem vereinbarten Regressverzicht vorsieht und ein solcher Ausnahmetatbestand erfüllt ist (hier bejaht für grobe Fahrlässigkeit).
2. Für das Eingreifen eines Ausnahmetatbestandes zum Regressverzicht trägt der regressierende Versicherer nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast. Allerdings trifft den versicherten Auftragnehmer eine sekundäre Darlegungslast, detailliert und bauablaufgetreu zu der als grob fahrlässig in Streit stehenden Art der Ausführung vorzutragen.
3. Treten Rissbildungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit Bauarbeiten auf, die generell geeignet sind, Bodenerschütterungen auszulösen, streitet der Beweis des ersten Anscheins für die Ursächlichkeit.
4. Eine zufällige Schadensverlagerung als Voraussetzung für eine Drittschadensliquidation liegt vor, wenn die vertragswidrige Bauausführung des Auftragnehmers zu einem Vermögensschaden in Form von nachbarrechtlichen Ersatzansprüchen nicht beim Auftraggeber, sondern beim (personenverschiedenen) Bauherrn führt.
5. Enthält eine Klausel neben der unwirksamen auch unbedenkliche, sprachlich und inhaltlich abtrennbare Bestimmungen, bleiben diese wirksam, auch wenn sie den gleichen Sachkomplex betreffen, wenn nach Wegstreichen der unwirksamen Teilregelung ein aus sich heraus verständlicher Klauselrest verbleibt (blue-pencil-Test).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2359
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Bamberg, Beschluss vom 11.09.2023 - 12 U 24/23
1. Verspricht ein Projektbetreuer gegenüber dem Bauherrn, für die Einhaltung einer bestimmten Bausumme einzustehen, kann seine Erklärung einen unterschiedlichen Inhalt haben, der stets im Einzelfall durch Auslegung festzustellen ist.
2. Für die Annahme einer selbständigen Garantie, bei der der Auftragnehmer verschuldensunabhängig - auch bei unvorhersehbaren Geschehensabläufen - für sämtliche die Garantiesumme übersteigenden Kosten haftet, sind hohe Anforderungen zu stellen.
3. Eine Baukostengarantie wird gegenstandslos, wenn die ursprüngliche Planung einvernehmlich geändert und in erweitertem Umfang ausgeführt wird.
4. Ein individuelles Aushandeln kann anzunehmen sein, wenn die streitgegenständliche Klausel im Zuge der Vertragsverhandlungen auf einen entsprechenden Wunsch des Verwendungsgegners abgeändert wird (hier bejaht).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2339
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 18.06.2024 - 21 U 20/23
1. Ob der Rücktritt von einem Vertrag gem. § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB wegen Unerheblichkeit der Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, ist anhand einer umfassenden Interessenabwägung im Einzelfall zu entscheiden.*)
2. Erklärt der Besteller den Rücktritt von einem Bauvertrag, so gilt: Je umfangreicher die Leistungen sind, die der Unternehmer bereits erbracht hat, desto mehr spricht dies im Rahmen der Interessenabwägung gegen die Wirksamkeit des Rücktritts.*)
3. Die Aufrechnung mit einem Anspruch auf Vorschuss für Mängelbeseitigungskosten gegenüber dem Vergütungsanspruch des Unternehmers ist nicht möglich, da es eine solche Aufrechnungslage nicht geben kann.*)
4. Behält der Werkbesteller die noch offene Vergütung des Unternehmers wegen der Kosten einer Mängelbeseitigung ein, so erhebt er damit die Dolo-agit-Einrede.*)
IBRRS 2024, 2295
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Beschluss vom 30.03.2023 - 27 U 192/22
1. Beim VOB/B-Vertrag steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf Mängelbeseitigungskostenvorschuss nur dann zu, wenn er den Zugang einer Fristsetzung mit Kündigungsandrohung darlegen und beweisen kann.
2. Bei einem Einwurf-Einschreiben kann der Zugangsnachweis nicht durch Vorlage des Einlieferungsbelegs und des Sendungsstatus geführt werden, da sich diesen nicht entnehmen lässt, dass eine Zustellung beim Erklärungsempfänger erfolgt ist.
3. Die Anwendung der Grundsätze des Anscheinsbeweises streiten nur dann zugunsten des Erklärenden, wenn der Briefkasteneinwurf des Einwurf-Einschreibens ordnungsgemäß dokumentiert wird. Dafür sind die Auslieferungsbelege entweder im Original oder als Reproduktion vorzulegen.
4. Eine endgültige und ernsthafte Verweigerung der Mängelbeseitigung, die eine Fristsetzung entbehrlich machen würde, kann nicht angenommen werden, wenn der Auftragnehmer eine Weiterarbeit für den Fall in Aussicht stellt, dass offene Vergütungsforderungen beglichen werden.
5. Eine verbindliche Fertigstellungsfrist wird obsolet, wenn die bei Vertragsschluss noch sehr unbestimmt und allgemein gehaltene Leistungsbeschreibung erst im Laufe der Bauarbeiten sukzessive konkretisiert wird.
6. § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B gewährt dem Auftraggeber vor Abnahme und bei aufrechterhaltenem Vertrag einen Anspruch auf den Ersatz des Schadens, der ihm dadurch entsteht, dass das Bauwerk deshalb später fertiggestellt wird, weil der Auftragnehmer während der Bauausführung eine mangelhafte oder vertragswidrige Leistung durch eine mangelfreie oder vertragsgemäße Leistung ersetzt. Gleiches gilt, wenn die verspätete Fertigstellung des Bauwerks dadurch mitverursacht wird, dass der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung über einen bestimmten Zeitraum vertragswidrig nicht ausführt (beides hier verneint).
7. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn setzt voraus, dass der Geschädigte die Umstände darlegt und in den Grenzen des § 287 ZPO beweist, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge oder den besonderen Umständen des Falles die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt. Dabei dürfen keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, wenn Ausgangs- und Anknüpfungstatsachen für eine Schadensschätzung vorgetragen werden.
8. Ein anspruchsminderndes Mitverschulden kommt in Betracht, wenn dem Auftraggeber eine Ingebrauchnahme trotz etwaiger Mängel möglich und zumutbar war.
IBRRS 2024, 2246
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2023 - 5 U 155/22
1. Als Schaden ersatzfähig sind alle notwendigen Aufwendungen, also alle Kosten, die der Auftraggeber als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Bauherr im Zeitpunkt der Beauftragung des Dritten für angemessen halten durfte, wobei es sich um eine vertretbare Maßnahme der Schadensbeseitigung handeln muss. Hat der Geschädigte sich sachkundig beraten lassen, kann er regelmäßig die Fremdnachbesserungskosten verlangen, die ihm aufgrund dieser Beratung entstanden sind.
2. Das mit der sachkundig begleiteten Beurteilung einhergehende Risiko einer Fehleinschätzung trägt der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat die Kosten selbst dann zu erstatten, wenn sich die zur Mängelbeseitigung ergriffenen Maßnahmen im Nachhinein als nicht erforderlich erweisen.
3. Der Erstattungsanspruch des Auftraggebers ist erst dann gemindert, wenn die Grenzen des von ihm für erforderlich haltbaren Aufwandes überschritten sind und er bei der Auswahl des Drittunternehmers die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet hat.
4. Der zwischen dem Geschädigten - respektive seiner Versicherung - und einem Gutachter geschlossene Gutachtervertrag zur Ermittlung der Anspruchshöhe entfaltet Schutzwirkung zu Gunsten der regulierungspflichtigen Haftpflichtversicherung.
5. Für die Einbeziehung in den Schutzbereich genügt es, wenn für den Gutachter erkennbar war, dass seine Ausarbeitung einer letztlich zahlungsverpflichteten Versicherung vorgelegt werden wird, denn damit ist die Schutzpflicht hinreichend überschaubar und klar abgegrenzt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2247
 Bauträger
Bauträger
OLG Köln, Beschluss vom 17.09.2021 - 7 U 173/20
1. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. Der Besteller ist zur Abnahme verpflichtet, wenn die Bauleistung fertig gestellt ist und allenfalls unwesentliche Mängel aufweist.
2. Ob ein Mangel wesentlich ist und deshalb zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, hängt von Art und Umfang des Mangels und seinen Auswirkungen ab. Das lässt sich nur unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls beurteilen. Auch bloß optische Beeinträchtigungen können das Maß des Zumutbaren überschreiten.
3. Die Gestaltung einer mittig gelegenen, 280 qm umfassenden Innenhoffläche mit einer wassergebundenen Decke anstelle einer Rasenfläche stellt einen wesentlichen Mangel dar.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1494
 Bauträger
Bauträger
OLG Köln, Beschluss vom 02.11.2021 - 7 U 173/20
1. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. Der Besteller ist zur Abnahme verpflichtet, wenn die Bauleistung fertig gestellt ist und allenfalls unwesentliche Mängel aufweist.
2. Ob ein Mangel wesentlich ist und deshalb zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, hängt von Art und Umfang des Mangels und seinen Auswirkungen ab. Das lässt sich nur unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls beurteilen. Auch bloß optische Beeinträchtigungen können das Maß des Zumutbaren überschreiten.
3. Die Gestaltung einer mittig gelegenen, 280 qm umfassenden Innenhoffläche mit einer wassergebundenen Decke anstelle einer Rasenfläche stellt einen wesentlichen Mangel dar.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2240
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Bayreuth, Urteil vom 14.07.2022 - 31 O 173/21
1. Wird ein BGB-Bauvertrag nachträglich erweitert, indem der Auftraggeber ein Angebot gegenzeichnet, an dessen Ende steht "Ausführung nach VOB/B ... liegt zur Einsichtnahme in unseren Geschäftsräumen aus", reicht dies nicht zu einer wirksamen Einbeziehung er VOB/B gegenüber einem Laien.*)
2. Es ist (ohne Fachplanung) Angelegenheit des Fussbodenlegers sicherzustellen, dass der ausgewählte Belag und dessen Befestigung für die zu belegende Fläche geeignet ist, falls er keine belastbaren Angaben zur Beschaffenheit des zu belegenden Objekts hat, muss er diese aufklären.*)
3. Bringt der Fussbodenleger, ohne solche Ermittlungen angestellt zu haben, einen dampfdichten Belag auf einem naturbelassenen Boden auf und kommt es in der Folge zu einer Verseifung des Klebers und Ablösung des Fussbodenbelags, handelt es sich um einen Baumangel.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2238
 Bauvertrag
Bauvertrag
EuGH, Urteil vom 11.07.2024 - Rs. C-279/23
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ist dahin auszulegen, dass er einer Praxis der nationalen Gerichte entgegensteht, die darin besteht, Klagen auf Zahlung des in dieser Bestimmung vorgesehenen Mindestpauschalbetrags als Entschädigung für Beitreibungskosten mit der Begründung abzuweisen, dass der Zahlungsverzug des Schuldners nicht erheblich sei oder dass der Betrag, mit dem der Schuldner in Verzug geraten sei, gering sei.*)
 Volltext
Volltext