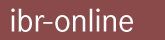Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Aktuelle Urteile zum Öffentlichen Bau- & Umweltrecht
Online seit gestern
IBRRS 2026, 0463 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 23.02.2026 - 1 LA 120/25
1. Auswahl und Zuschnitt der Fragestellung eines Bauvorbescheids liegen in der Entscheidungsfreiheit des Antragstellers mit der Maßgabe, dass nur Fragen, über die im Baugenehmigungsverfahren zu entscheiden wäre und die selbstständig beurteilt werden können, Gegenstand der Bauvoranfrage sein können.*)
2. Hält sich die vom Antragsteller gestellte Frage innerhalb dieser Grenzen, bestimmt sie auch das Prüfprogramm der Bauaufsichtsbehörde. Spiegelbildlich ist aber auch die Wirkung des erteilten positiven Bauvorbescheids entsprechend beschränkt.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 26. Februar
IBRRS 2026, 0443 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 20.01.2026 - 1 LA 114/25
Von im Angesicht des Falles getroffenen und damit den erklärten planerischen Willen der Gemeinde ausdrückenden Festsetzungen kann grundsätzlich keine Befreiung erteilt werden (Bestätigung der ständigen Senatsrspr., vgl. Senatsbeschl. v. 02.12.2016 - 1 LA 77/16, IBRRS 2017, 0245 = BauR 2017, 512 = BRS 84 Nr. 67).*)
 Volltext
Volltext
Online seit 25. Februar
IBRRS 2026, 0433 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 02.02.2026 - 9 ZB 24.2142
1. Ist ein landwirtschaftlicher Betrieb vorhanden, können einzelne Betätigungen - die bei isolierter Betrachtung landwirtschaftsfremd sind - durch ihre betriebliche Zuordnung zu der landwirtschaftlichen Tätigkeit von dieser gleichsam mitgezogen werden und damit an der Privilegierung teilnehmen, wenn es sich bei dem nicht privilegierten Betriebsteil gegenüber dem privilegierten Betrieb nur um eine bodenrechtliche Nebensache handelt, er dem landwirtschaftlichen Betrieb zu- und untergeordnet ist und ihm zur Erhaltung und Existenzsicherung eine zusätzliche Einkommensquelle schaffen soll.
2. Die Teilhabe eines zweckmäßigerweise angegliederten, für sich genommen nichtlandwirtschaftlichen Betriebsteils an der Privilegierung des Gesamtbetriebs findet ihre Grenze an dem Gebot, den Außenbereich grundsätzlich von ihm fremden Belastungen freizuhalten. Es muss daher auch hinsichtlich der "mitgezogenen" Nutzung noch ein enger Zusammenhang mit der Bodenertragsnutzung in ihren vielfältigen Formen gegeben sein.
 Volltext
Volltext
Online seit 24. Februar
IBRRS 2026, 0422 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 02.02.2026 - 2 B 24.2129
1. Ein Bauvorhaben fügt sich nur dann nach dem Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung ein, wenn es dort Referenzobjekte gibt, die bei einer wertenden Gesamtbetrachtung von Grundfläche, Geschosszahl und Höhe, bei offener Bebauung auch nach dem Verhältnis zur Freifläche, vergleichbar sind.
2. Gebäude prägen ihre Umgebung nicht durch einzelne Maßbestimmungsfaktoren, sondern erzielen ihre optische maßstabsbildende Wirkung durch ihr gesamtes Erscheinungsbild. Die Übereinstimmung von Vorhaben und Referenzobjekten nur in einem Maßfaktor genügt nicht.
3. Es existiert kein Grundsatz, nach dem eine Überschreitung allgemein anhand eines prozentualen Maßstabes als nicht rahmenüberschreitend gilt; es bedarf stets einer wertenden Einzelfallbetrachtung.
4. Ein Vorhaben ist geeignet, bodenrechtliche Spannungen zu begründen, wenn die von ihm ausgehende Bezugsfallwirkung zu einer Nachverdichtung in der näheren Umgebung führen kann.
 Volltext
Volltext
Online seit 23. Februar
IBRRS 2026, 0421 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 25.11.2025 - 1 N 23.932
Eine Planung kann in nicht zu beanstandender Weise zur Sicherung von Freiflächen und Sichtbeziehungen landwirtschaftliche Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, festsetzen. Schließt ein Bebauungsplan eine (weitere) Bebauung aus, so setzt eine ordnungsgemäße Abwägung voraus, dass nicht nur die städtebauliche Erforderlichkeit der Festsetzung in die Erwägungen eingestellt wird.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 20. Februar
IBRRS 2026, 0411 Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 04.02.2026 - 4 LA 61/25
1. Die gerichtliche Aufklärungspflicht findet dort ihre Grenze, wo das Vorbringen der Beteiligten keinen tatsächlichen Anlass zu weiterer Aufklärung bietet. Hierbei kommt auch einem Privatgutachten - ebenso wie der Vorlage einer schriftlichen Auskunft - die Bedeutung eines qualifizierten substantiierten Beteiligtenvorbringens zu, welches vom Tatsachengericht verwertet werden kann.*)
2. Ergreift oder unterlässt die Behörde von einer Ermessensermächtigung gedeckte Maßnahmen zur Bekämpfung rechtswidriger Zustände, so gebietet Art. 3 Abs. 1 GG, in vergleichbaren Fällen in der gleichen Art und Weise zu verfahren. Das bedeutet bei einer Vielzahl von Verstößen zwar nicht, dass sie gleichzeitig tätig werden muss. Es ist ihr indes verwehrt, systemlos oder willkürlich vorzugehen. Von diesen Anforderungen ist gedeckt, wenn bei Vorliegen sachlicher Gründe sich die Behörde im Wege eines gestuften Vorgehens darauf beschränkt, zunächst einen Einzelfall herauszugreifen und die Verhältnisse nach und nach zu bereinigen.*)
3. Dem Rechtsinstitut der Verwirkung unterliegen nur subjektiv verzichtbare Rechte, nicht aber öffentlichrechtliche Berechtigungen und Verpflichtungen. Eine Verwirkung von hoheitlichen Eingriffsbefugnissen wie eine auf § 3 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 2 NNatSchG gestützte Beseitigungsanordnung kommt daher bereits vom Ansatz her nicht in Betracht. Demzufolge hindert die bloße langjährige Hinnahme eines naturschutzwidrigen Zustandes die untere Naturschutzbehörde nicht, auch später die Herstellung rechtmäßiger Zustände zu fordern. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die untere Naturschutzbehörde über die reine Untätigkeit hinaus ein positives Verhalten an den Tag gelegt hat, aufgrund dessen der Betroffene darauf vertrauen durfte, die Behörde werde von ihrer Eingriffsbefugnis keinen Gebrauch machen.*)
4. Es liegt kein Ermessensfehler darin, den Adressaten einer Beseitigungsanordnung die Mehrkosten einer - im Übrigen auch insgesamt in Bezug auf die Kostenhöhe zumutbaren - Beseitigung naturschutzwidriger Zustände tragen zu lassen, welche dadurch entstanden sind, dass er einem Beseitigungsverlangen der Behörde über einen langen Zeitraum nicht nachgekommen ist. Denn dies ist Folge seines eigenen, pflichtwidrigen Verhaltens und begründet nicht die Unverhältnismäßigkeit der Anordnung.*)
5. Der Charakter der durch eine Landschaftsschutzgebietsverordnung geschützten Landschaft wird nicht durch angrenzende Wohngebiete bestimmt. Aus Vorgaben eines die angrenzende Wohnbebauung betreffenden Flächennutzungsplanes, wonach auf einen angemessenen Übergang der Bebauung zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet geachtet werden solle, und damit einhergehender Beschränkungen der Eigentumsrechte für die an das Schutzgebiet angrenzende Wohnbebauung folgt nicht spiegelbildlich auch eine Erweiterung der Eigentumsrechte für Eigentümer von Grundstücken im Landschaftsschutzgebiet.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 19. Februar
IBRRS 2026, 0403 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.01.2026 - OVG 7 A 25/25
Die Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie durch einen Regionalplan nach dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen vom 20. Juli 2022 entfaltet als Ziel der Raumordnung keine außergebietliche Ausschlusswirkung.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 18. Februar
IBRRS 2026, 0307 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 28.01.2026 - 1 ZB 24.2124
1. Die Verschlechterung des baulichen Zustands durch stetigen Verfall im Laufe der Zeit ist kein außergewöhnliches Ereignis i.S.d. § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.
2. Maßgebend ist nicht die subjektive Sicht des Bauherrn, sondern ob es sich bei objektiver Betrachtung der baulichen Situation um ein außergewöhnliches Ereignis handelt, wie es bei einem Brand oder einem Naturereignis in der Regel der Fall ist.
 Volltext
Volltext
Online seit 17. Februar
IBRRS 2026, 0379 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20.01.2026 - 10 D 92/25
1. § 9 Abs. 2a BauGB ermöglicht auch den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben, die ein nicht zentrenrelevantes Hauptsortiment vertreiben und über ein zentrenrelevantes Randsortiment von mehr als 10% verfügen.*)
2. Die Möglichkeit zur Feindifferenzierung in § 9 Abs. 2a BauGB wird lediglich dadurch begrenzt, dass sie sich auf bestimmte Anlagen- oder Betriebstypen beziehen muss, die es in der sozialen und ökonomischen Realität bereits gibt.*)
3. Eine Festsetzung nach § 9 Abs. 2a BauGB kann auch darauf gerichtet sein, die Attraktivität der Zentren zu steigern oder, wenn sie ihre Funktion verloren haben, diese wieder zu entwickeln.*)
4. Werden in einem Bebauungsplan auf der Grundlage eines Einzelhandelskonzepts zentrenrelevante Sortimente für ein Gebiet außerhalb der Zentren ausgeschlossen, ist im Sinne eines Regel-Ausnahme-Prinzips ein Förderpotenzial hinsichtlich des in § 9 Abs. 2a BauGB normativ vorgegebenen Ziels der Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche grundsätzlich zu bejahen.*)
5. Die städtebauliche Rechtfertigung eines Einzelhandelsausschlusses nach § 9 Abs. 2a BauGB bedarf einer eingehenden Begründung des Bebauungsplans, aus der sich ergibt, dass und warum nach der jeweiligen konkreten Planungssituation ein solcher zur Förderung des Planziels geeignet ist.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 16. Februar
IBRRS 2026, 0376 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 26.03.2025 - 3 LB 154/20
1. Der Bestandsschutz eines Gebäudes erlischt, wenn die Nutzung endgültig aufgegeben wird. Maßgeblich ist, ob aufgrund einer Gesamtbetrachtung aus der Sicht eines objektiven Dritten unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls hinreichend eindeutig davon auszugehen ist, dass der Eigentümer auf die weitere Nutzung endgültig und dauerhaft verzichten will. Dabei sind u.a. der Zustand des Gebäudes und die Dauer des Leerstands zu berücksichtigen.*)
2. Ist nur die Nutzung des Gebäudes zu betrieblichen Wohnzwecken bestandsgeschützt, so führt der endgültige Wegfall der Koppelung an den Betrieb zum Erlöschen des Bestandsschutzes.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 13. Februar
IBRRS 2026, 0356 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 15.12.2025 - 4 BN 6.25
1. Die Pflicht zu einer erneuten Auslegung eines Bauleitplans besteht, wenn dessen Entwurf mit den seinen normativen Inhalt ausmachenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen geändert oder ergänzt wird.
2. Diese Pflicht besteht nicht, wenn die nach öffentlicher Auslegung vorgenommene Ergänzung einer Festsetzung lediglich klarstellende Bedeutung hat. Gleiches gilt, wenn der Entwurf in Punkten geändert worden ist, zu denen die betroffenen Bürger, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zuvor bereits Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, die Änderungen auf einem ausdrücklichen Vorschlag eines Betroffenen beruhen und Dritte hierdurch nicht abwägungsrelevant berührt werden.
3. Sog. "Summenpegel" sind unzulässig, gleichwohl können Emissionskontingente festgesetzt werden, die das Emissionsverhalten jedes einzelnen von der Festsetzung betroffenen Betriebes und jeder einzelnen Anlage regeln.
 Volltext
Volltext
Online seit 12. Februar
IBRRS 2026, 0265 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Sachsen, Urteil vom 16.10.2025 - 1 C 32/23
1. Sowohl für die Frage, ob die von den Windkraftanlagen ausgehenden Geräusche zu erheblichen Nachteilen und Belästigungen für die Nachbarschaft führen, als auch für die Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme durch den auf die Wohnhäuser des Nachbarn einwirkenden Lärm sind in ihrem Anwendungsbereich die Bestimmungen der TA Lärm heranzuziehen.
2. Infraschall durch Windkraftanlagen führt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Gehörs nach dem bisherigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich nicht zu Gesundheitsgefahren führt.
3. Der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung steht einem Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windkraftanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windkraftanlage entspricht. Eine Abweichung im Einzelfall ist demnach zwar möglich, um unzumutbare Auswirkungen zu verhindern, sie setzt aber einen atypischen, vom Gesetzgeber so nicht vorhergesehenen Sonderfall voraus.
 Volltext
Volltext
Online seit 11. Februar
IBRRS 2026, 0288 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 02.12.2025 - 1 C 10523/24
1. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauGB erlaubt sind nur solche Festsetzungen, bei denen die allgemeine Zweckbestimmung des § 7 Abs. 1 BauNVO gewahrt wird. Dies ist bei einer Festsetzung, wonach sonstige Wohnungen (nur) oberhalb des Erdgeschosses zulässig sind, und einer im Bebauungsplan vorgegebenen Bebauung mit mindestens drei und höchstens vier Geschossen nicht der Fall.*)
2. Ein Bebauungsplan wahrt nicht die Anforderungen an eine dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB genügende Konfliktbewältigung, wenn ein Baugebiet für Fahrzeuge der Abfallentsorgung nicht zugänglich und zugleich unklar ist, wo ein Müll-Sammelplatz im Planvollzug geschaffen werden kann.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 10. Februar
IBRRS 2026, 0263 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18.12.2025 - 2 S 42.25
1. Materielle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung einer Veränderungssperre ist ein Aufstellungsbeschluss. Ein solcher liegt im Rechtssinne allerdings dann nicht vor, wenn er zwar gefasst, aber nicht ortsüblich bekanntgemacht wurde.
2. Ein Bekanntmachungsmangel des Aufstellungsbeschlusses führt zur Unwirksamkeit der Veränderungssperre.
3. Im Falle eines Verstoßes gegen das Erfordernis der ortsüblichen Bekanntmachung eines Aufstellungsbeschlusses ist § 214 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der als Satzung erlassenen Veränderungssperre nicht anwendbar.
 Volltext
Volltext
Online seit 9. Februar
IBRRS 2026, 0301 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 16.12.2025 - 7 B 18.25
1. Das Rücksichtnahmegebot lenkt den Blick auf die konkrete Situation der benachbarten Grundstücke mit dem Ziel, einander abträgliche Nutzungen in rücksichtsvoller Weise einander zuzuordnen sowie Spannungen und Störungen zu verhindern. Dabei ermöglicht und gebietet das Rücksichtnahmegebot zusätzliche Differenzierungen im Wege einer "Feinabstimmung".
2. Bei der Beurteilung von Konfliktsituationen sind faktische Vorbelastungen zu berücksichtigen und es kann auf die Frage ankommen kann, in welchem baurechtlichen Gebiet die vorhandene und die heranrückende Nutzung stattfindet und welche Nutzung eher vorhanden war.
3. Das Tatsachengericht kann sich ohne Verstoß gegen seine Aufklärungspflicht auf Gutachten oder gutachterliche Stellungnahmen stützen, die eine Behörde im Verwaltungsverfahren eingeholt hat. Gleiches gilt für vom Vorhabenträger im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren eingereichte Gutachten oder gutachterliche Stellungnahmen.
4. Ein Verfahrensmangel liegt in dieser Situation nur dann vor, wenn sich dem Tatsachengericht die Einholung eines weiteren Gutachtens hätte aufdrängen müssen, weil die vorliegenden Gutachten ungeeignet sind, ihm die für die richterliche Überzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen zu vermitteln.
 Volltext
Volltext
Online seit 6. Februar
IBRRS 2026, 0289 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29.12.2025 - 7 B 985/25
Das Interesse des Eigentümers eines außerhalb des Planbereichs gelegenen Grundstücks, bei der späteren Realisierung des Bebauungsplans nicht von baustellenbedingten Auswirkungen beeinträchtigt zu werden, gehört wegen der zeitlichen Begrenzung dieser Auswirkungen grundsätzlich nicht zu den Belangen, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind. Planbedingt sind nur solche Nachteile, die die Festsetzungen des Bebauungsplans den Betroffenen auf Dauer auferlegen.
 Volltext
Volltext
Online seit 5. Februar
IBRRS 2026, 0261 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 12.12.2025 - 12 MS 43/24
1. Die Rückbaupflicht nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist grundsätzlich umfassend und schließt demnach die Beseitigung unterirdischer Anlagenteile, wie Pfahlgründungen bei Windenergieanlagen, ein. Auch die für solche Beseitigungen voraussichtlich anfallenden Kosten müssen daher durch eine Bürgschaft als Sicherheitsleistung nach § 35 Abs. 5 Satz 3 BauGB abdeckt sein.*)
2. Eine Genehmigung nach § 4 BImSchG für eine Windenergieanlage schließt die Feststellung ihrer Standsicherheit ein. Zu den Grenzen, in denen ein Prüfingenieur für Baustatik insoweit Aufgaben der Genehmigungsbehörde übernehmen kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2026, 0262
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Beschluss vom 13.01.2026 - 1 SN 25.8168
1. Ein Nachbar kann die unzureichende inhaltliche Bestimmtheit einer Baugenehmigung geltend machen, soweit dadurch nicht sichergestellt ist, dass das genehmigte Vorhaben allen dem Nachbarschutz dienenden Vorschriften entspricht.
2. Nach bayerischem Bauordnungsrecht sind die Bauunterlagen mit einem sichtbaren Genehmigungsvermerk zu versehen, der auf dem Lageplan, den Bauzeichnungen, der Baubeschreibung und den technischen Nachweisen anzubringen ist.
3. Nicht mit Genehmigungsvermerk versehene Unterlagen können allenfalls dann zur Auslegung des Inhalts der Baugenehmigung herangezogen werden, wenn anderweitig im Genehmigungsbescheid oder in den Bauvorlagen Bezug auf sie genommen wird.
 Volltext
Volltext
Online seit 4. Februar
IBRRS 2026, 0172 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 02.12.2025 - 2 B 23.1375
1. Der Begriff des landwirtschaftlichen Betriebs erfordert neben der persönlichen Eignung des Betreibers ein auf Dauer angelegtes, mit Gewinnerzielungsabsicht betriebenes und auch zur Gewinnerzielung geeignetes Unternehmen.
2. Die Pensionspferdehaltung ist dadurch gekennzeichnet , dass der unmittelbare Bezug zur Bodenertragsnutzung gelockert und der Übergang von der (noch) landwirtschaftlichen zu einer die Freizeitnutzung ("Reiterhof") in den Vordergrund stellenden gewerblichen Betriebsweise fließend und nur schwer nachprüfbar ist, weshalb eine kritische Prüfung angezeigt ist.
3. Ein landwirtschaftlicher Betrieb setzt eine spezifische betriebliche Organisation und eine Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung voraus. Es muss sich um ein auf Dauer gedachtes und auch lebensfähiges Unternehmen handeln; auch eine landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle kann dabei grundsätzlich ein Betrieb in diesem Sinne sein.
 Volltext
Volltext
Online seit 3. Februar
IBRRS 2026, 0231 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11.12.2025 - 1 A 11292/24
1. Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung enthält nicht konkludent zugleich einen Antrag auf Erteilung der notwendigen Sanierungsgenehmigung (im Anschluss an BVerwG, Beschluss vom 08.03.2001 - 4 B 76.00 -). Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann es der Baugenehmigungsbehörde im Einzelfall aber verwehrt sein, sich auf das Fehlen des sanierungsrechtlichen Antrags zu berufen.*)
2. Die in § 145 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB geregelte Genehmigungsfiktion hinsichtlich der Sanierungsgenehmigung tritt auch bei Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ein.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2. Februar
IBRRS 2026, 0156 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 17.09.2025 - 2 B 23.1262
1. Die Anwendung der sog. Doppelhausrechtsprechung scheidet bei geschlossener Bauweise aus.
2. Eine offene Bauweise in Form einer Hausgruppe kann nur vorliegen, wenn deren Länge bezogen auf die jeweils seitlichen Grundstücksgrenzen nicht mehr als 50 m beträgt (hier verneint).
 Volltext
Volltext
Online seit 30. Januar
IBRRS 2026, 0173 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 09.01.2026 - 22 B 1243/25
1. Ob die im Rahmen der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens von der Genehmigungsbehörde gewährte Anhörungsfrist (noch) angemessen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 02.07.2021 - 7 B 286/21).*)
2. Will sich eine Gemeinde (nachträglich) auf eine nicht ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme zur beabsichtigten Ersetzung ihres versagten Einvernehmens berufen, kann sie nicht zugleich innerhalb des ihr genannten Zeitraums abschließend Stellung nehmen.*)
3. Die zeichnerischen Darstellungen eines Regionalplans sind nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts nur gebiets- und nicht parzellenscharf. Aufgrund dieser Unschärfe bleibt die Zuordnung einzelner Grundstücke in den Randbereichen im Sinne einer zulässigen "Arrondierung" noch interpretierbar und die zeichnerische Darstellung ist nicht als räumlich exakte Abgrenzung zu verstehen.*)
4. Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass ein Regionalplan auch Windenergiegebiete im Sinne des § 2 Nr. 1 WindBG (hier in Gestalt einer Rotor-außerhalb-Planung) umfasst, sowie der damit verbundenen Rechtsfolge des § 249 Abs. 2 BauGB.*)
 Volltext
Volltext