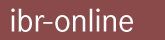Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Aktuelle Urteile zum Öffentlichen Bau- & Umweltrecht
Online seit heute
IBRRS 2025, 1166 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 26.03.2025 - 5 S 584/24
Der in § 11 Abs. 4 LBO-BW genannte Begriff der "für Anschläge bestimmte Werbeanlagen" umfasst auch (unbeleuchtete) Werbetafeln für großformatige Fremdwerbung und reduziert den Anwendungsbereich nicht auf etwa nur solche Anlagen, die das örtliche Informationsbedürfnis der Bewohner befriedigen und der besonderen Funktion dieser vorwiegend zum Wohnen dienenden Gebiete entsprächen (im Anschluss an VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 14.10.2022 - 8 S 2135/21 -, IBRRS 2022, 3230).*)
 Volltext
Volltext
Online seit gestern
IBRRS 2025, 0978 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 21.03.2025 - 1 ZB 24.1837
1. Ob eine Veränderung der für ein Vorhaben charakteristischen Merkmale die Identität von genehmigten und errichteten Vorhaben aufhebt, hängt vom Umfang der Abweichungen und von der Bewertung ihrer Erheblichkeit im jeweiligen Einzelfall ab. Es kommt dabei entscheidend darauf an, ob durch die Änderung Belange, die bei der ursprünglichen Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigt waren, neuerlich oder andere Belange erstmals so erheblich berührt werden, dass sich die Zulässigkeitsfrage neu gestellt (hier bejaht für Umnutzung eines Sägewerks zu fünf Ferienwohnungen).
2. Die Anreihung von Gebäuden entlang einer öffentlichen Verkehrsfläche reicht für eine organische Siedlungsstruktur nicht aus, sondern eine bandartige Bebauung oder eine verglichen mit einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil weniger dichte Bebauung können gerade Merkmale einer Splittersiedlung sein.
 Volltext
Volltext
Online seit 7. Mai
IBRRS 2025, 1170 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25.02.2025 - 10 D 102/22
1. Wird in einer Festsetzung in einem Bebauungsplan auf eine bestimme Fassung einer DIN-Vorschrift Bezug genommen, müssen sich die Planbetroffenen von deren Inhalt verlässlich Kenntnis verschaffen können. Dafür reicht es nicht, dass eine andere Fassung der DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, bereit gehalten wird.*)
2. Eine Festsetzung in einem Bebauungsplan ist unbestimmt, wenn angesichts der Angabe unterschiedlicher Fassungen einer DIN-Vorschrift in der Planurkunde unklar bleibt, auf welche Fassung diese Festsetzung Bezug nimmt.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 6. Mai
IBRRS 2025, 1034 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Urteil vom 13.03.2025 - 1 KN 82/23
1. Der in § 6a Abs. 1 BauNVO niedergelegten Zweckbestimmung des Urbanen Gebiets sind auch im Wege der Auslegung keine Tatbestandsmerkmale zu entnehmen, die auf das Erfordernis eines urbanen Charakters des festgesetzten Gebiets (etwa hinsichtlich Gemeindegröße, Verdichtung des Gebiets, Vorhandenseins von Einzelhandel und Gastronomie) hinauslaufen.*)
2. Zur Abwägungserheblichkeit des Interesses am Erhalt eines bereits reduzierten Freiraums in den rückwärtigen Grundstücksbereichen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 5. Mai
IBRRS 2025, 1140 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.04.2025 - 3 S 318/25
Die aus einer gegenüber einem Mieter erlassenen Duldungsverfügung folgende Pflicht, die Durchsetzung der gegenüber einem Grundstückseigentümer ausgesprochenen baurechtlichen Nutzungsuntersagung hinzunehmen, gestaltet die zivilrechtliche Lage. Die Abwehransprüche des Mieters aus dem Mietvertrag und aus dem Besitz nach § 862 Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen und dem Vermieter ist die Erfüllung der nach § 535 Abs. 1 Satz 1 BGB bestehenden Pflicht zur Gebrauchsüberlassung gemäß § 275 Abs. 1 BGB unmöglich.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2. Mai
IBRRS 2025, 1078 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27.09.2024 - 22 D 48/24
1. Ein Planungskonzept nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, das - entgegen der von der Rechtsprechung geforderten Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen sowie von sich nach deren Abzug ergebenden Potenzialflächen - die planerische Darstellung von großflächigen Tabubereichen innerhalb von Potenzialflächen und auch nachfolgend innerhalb einer Konzentrationszone vorsieht, ist abwägungsfehlerhaft.*)
2. Ein vom Plangeber errechneter Abstandsmittelwert, der ohne nähere Begründung nicht zwischen den Baugebietstypen der Baunutzungsverordnung (hier v. a. WR, WA und MI, MD) differenziert, ist als weiches Tabukriterium nicht hinreichend städtebaulich legitimiert.*)
3. Die beabsichtigte Verhinderung einer übermäßigen Umfassung von einzelnen Ortslagen im Rahmen der Abwägung der einzelnen Potenzialflächen ist jedenfalls dann abwägungsfehlerhaft, wenn sich der Plangeber nicht mit den städtebaulichen Aspekten, die hierdurch berührt sein sollen, im Einzelnen hinreichend auseinandersetzt und die für das gesamte Gemeindegebiet zur Anwendung gebrachten Kriterien der "Einkreisung" erkennbar nicht sachgerecht sind.*)
4. Die mit Blick auf die Neuregelung in § 249 Abs. 1 BauGB geschaffene Überleitungsvorschrift des § 245e Abs. 1 Satz 1 BauGB, wonach die Rechtswirkungen eines Flächennutzungsplans nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für Windenergievorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nur dann fortgelten, wenn der Plan bis zum 1.2.2024 wirksam geworden ist, lässt keinen Raum für ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 30. April
IBRRS 2025, 0936 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Köln, Beschluss vom 31.01.2025 - 2 L 2386/24
1. Die Bauaufsichtsbehörde ist - auch bei beschränktem Prüfungsumfang im vereinfachten Genehmigungsverfahren - grundsätzlich befugt, Brandschutzbelange zu prüfen, wenn sie Rechtsverstöße erkennt, die außerhalb ihrer obligatorischen Prüfungspflicht liegen. Sie ist hierzu sogar verpflichtet, wenn die Gefährdung hochwertiger Rechtsgüter wie Leben oder Gesundheit von Menschen droht oder brandschutzrechtlich relevante Maßnahmen alleiniger Genehmigungsgegenstand sind.
2. Werden die Vorschriften des Abstandflächenrechts eingehalten, so bedeutet dies in aller Regel, dass das Bauvorhaben damit zugleich unter denjenigen Gesichtspunkten, welche Regelungsziele der Abstandsvorschriften sind (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung eines ausreichenden Sozialabstands), jedenfalls aus tatsächlichen Gründen auch nicht gegen das bauplanungsrechtliche Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme verstößt.
 Volltext
Volltext
Online seit 29. April
IBRRS 2025, 1082 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 26.03.2025 - 3 S 97/25
1. Eine Verletzung der Soll-Verpflichtung zu Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB begründet nicht die Unwirksamkeit eines Bebauungsplans. Denn solche Kennzeichnungen haben keine Regelungswirkung, sondern nur eine Hinweisfunktion (Bestätigung der Rspr., vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 04.05.1972 - II 199/72 -, DÖV 1972, 821 <822>).*)
2. Ein Unterlassen von Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB kann auf einen Abwägungsfehler hindeuten, wenn der Plangeber entgegen § 2 Abs. 3, § 1 Abs. 7 BauGB nicht erkannt und ermittelt hat, ob besondere bauliche Vorkehrungen oder Sicherungsmaßnahmen i.S.v. § 9 Abs. 5 BauGB angezeigt sein können.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 28. April
IBRRS 2025, 0934 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Schleswig, Urteil vom 20.03.2025 - 8 A 66/22
1. Die Vorschrift, nach der ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben gilt, ist nicht auf die Weiterleitung von Bauvorlagen von Gemeinden an die Bauaufsichtsbehörden anwendbar.
2. Der Bebauungszusammenhang endet am Ortsrand nicht im Bereich von Grundstücksgrenzen oder am Ende einer (mehr oder weniger breit befestigten) Fahrstraße, sondern mit den "letzten" tatsächlich vorhandenen (maßstabbildenden) Gebäuden. Die sich daran anschließenden selbständigen Flächen gehören zum Außenbereich. Ein Grundstück am Rande eines Ortsteils liegt daher in aller Regel nicht innerhalb des Bebauungszusammenhanges.
3. Das Außenbereichsvorhaben bereits dann unzulässig, wenn ein in § 35 Abs. 3 BauGB (beispielhaft) genannter Belang beeinträchtigt wird. Es bedarf weder mehrerer kumulierender Belange noch findet eine Abwägung, Saldierung oder Kompensation eines "beeinträchtigten" Belanges gegen andere (eventuell) "begünstigte" Belange statt.
 Volltext
Volltext
Online seit 25. April
IBRRS 2025, 1042 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20.09.2024 - 10 D 183/22
1. Für die Annahme eines Siedlungsbereichs, innerhalb dessen eine Maßnahme der Innenentwicklung i.S.v. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB nur zulässig ist, reicht eine lockere Zusammengehörigkeit aus; auf das Vorliegen eines Bebauungszusammenhangs kommt es nicht an.*)
2. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine einheitliche Freifläche innerhalb der Ortslage dem Siedlungsbereich zuordnen ist, ist auf die gesamte tatsächlich vorhandene Freifläche abzustellen und nicht nur auf deren von dem Bebauungsplan umfassten Teil.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 24. April
IBRRS 2025, 1043 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30.01.2025 - 7 A 501/24
1. Der Gebietsgewährleistungsanspruch begründet regelmäßig kein Abwehrrecht gegen Mehrfamilienhäuser in einem bisher durch Einfamilienhausbebauung geprägten Gebiet.
2. Grundstückseigentümer haben es in bebauten innerstädtischen Wohngebieten grundsätzlich hinzunehmen, dass Grundstücke innerhalb des Rahmens baulich genutzt werden, den das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht vorgeben, und dass es dadurch auch zu Einsichtnahmemöglichkeiten kommt, die in bebauten Gebieten üblich sind. Vielmehr entspricht es in bebauten Gebieten dem Regelfall, dass aus den Fenstern - und auch von den Balkonen - eines Wohnhauses Blicke auf Nachbargrundstücke geworfen werden können.
 Volltext
Volltext
Online seit 23. April
IBRRS 2025, 1041 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Beschluss vom 25.03.2025 - 1 S 25.446
1. In Anbetracht der Dringlichkeit der Unterbringung von Flüchtlingen sind an die vorzunehmende Subsidiaritätsprüfung keine übersteigerten Anforderungen zu stellen. Der Bedarfsdeckung kommt ein höheres Gewicht zu als einer erschöpfenden Subsidiaritätsprüfung.
2. Bei einer befristeten Baugenehmigung (hier: für den Neubau einer Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden) ist für den Fristbeginn auf den Zeitpunkt der Genehmigungserteilung abzustellen und nicht etwa auf den Baubeginn oder die Nutzungsaufnahme.
3. Beschränkt sich die Bescheidsbegründung im Wesentlichen auf die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts, kann sich aus dem Gesamtzusammenhang gleichwohl ergeben, dass ein (geringer) Ermessensspielraum ausgenutzt und eine ausreichende Ermessensentscheidung getroffen wurde.
4. Die Erschließung eines Vorhabengrundstücks ist auch dann gesichert, wenn Abwasserleitungen widerrechtlich über ein fremdes Grundstück führen.
 Volltext
Volltext
Online seit 22. April
IBRRS 2025, 1040 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Beschluss vom 26.03.2025 - 8 SN 25.1296
1. Ein Nachbar hat zwar keinen materiellen Anspruch darauf, dass der Bauantragsteller einwandfreie und vollständige Bauvorlagen einreicht. Nachbarrechte können aber dann verletzt sein, wenn infolge der Unbestimmtheit der Bauvorlagen der Gegenstand und Umfang der Baugenehmigung nicht eindeutig festgestellt und deshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass das genehmigte Vorhaben gegen nachbarschützendes Recht verstößt.
2. Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen vermitteln in der Regel keinen Drittschutz. Etwas anderes kann bei einem entsprechenden Willen des Plangebers gelten.
3. Eine erdrückende, das Rücksichtnahmegebot verletzende Wirkung scheidet regelmäßig aus, wenn der geplante Baukörper nicht erheblich höher ist als der des klagenden Nachbarn.
4. Bei Abweichungen von drittschützenden Vorschriften kann der Nachbar die objektive Rechtswidrigkeit einer erteilten Abweichung rügen.
 Volltext
Volltext
Online seit 17. April
IBRRS 2025, 0897 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18.03.2025 - 10 S 37/24
Das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme ist bei zu Wohnzwecken dienenden Bauvorhaben, die lediglich deutlich größer ausfallen und mehr Bewohnern dienen als ein Einfamilienhaus auf dem Nachbargrundstück, im Regelfall weder wegen einer vermeintlich erdrückenden Wirkung noch wegen vermeintlich unzumutbarer Einsichtsmöglichkeiten verletzt, wenn das Vorhaben die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Abstandsflächentiefe wahrt oder sogar das Vorhaben einen größeren Abstand von der Grundstücksgrenze einhält.
 Volltext
Volltext
Online seit 16. April
IBRRS 2025, 0609 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VerfGH Bayern, Entscheidung vom 05.02.2025 - Vf. 7-VII-23
1. Mit dem Entfall der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis für die Errichtung von Windenergieanlagen nach Art. 6 Abs. 5 und Art. 7 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BayDSchG entfällt für nicht besonders landschaftsprägende Denkmäler auch die Prüfung der entsprechenden materiellen Anforderungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes im bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.*)
2. Die Regelungen beschränken als Inhalts- und Schrankenbestimmungen die Rechte der Eigentümer von Denkmälern in verfassungsgemäßer Weise. Sie sind insbesondere - auch in der Zusammenschau mit den gesetzlichen Pflichten, die mit dem Eigentum an einem Denkmal verbunden sind - nicht unverhältnismäßig und berühren nicht den Wesensgehalt des Eigentums.*)
3. Art. 6 Abs. 5 und Art. 7 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BayDSchG stellen angesichts de Bedeutung des gesetzgeberischen Ziels des Klimaschutzes als Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einen angemessenen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse an einem beschleunigten Ausbau von Windenergieanlagen und den privaten Interessen der Denkmaleigentümer dar. Da der Denkmalschutz aufgrund bundes- und landesrechtlicher Vorgaben (§ 2 Sätze 1 und 2 EEG 2023 und Art. 2 Abs. 5 Satz 2 BayKlimaG) in Konfliktfällen ohnehin regel- mäßig zurückzutreten hat und die bundesrechtlich über § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB vermittelte Klagebefugnis von der Änderung des Landesdenkmalrechts unberührt bleibt, ist mit den Vorschriften allenfalls eine geringe zusätzliche Schmälerung der Rechtsposition der Denkmaleigentümer verbunden.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 15. April
IBRRS 2025, 0426 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 01.10.2024 - 8 D 2/22
1. a) Es ist im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 3 Satz 1 TA Lärm dauerhaft sichergestellt, dass der Lärmrichtwert am Immissionsort nicht um mehr als 1 dB(A) überschritten wird, wenn vorhandene Anlagen für etwaige Betriebsänderungen, die mit einer erhöhten Lärmbelastung verbunden sein könnten, einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, in deren Rahmen die Einhaltung der Lärmrichtwerte wiederum durch die Genehmigungsbehörde zu prüfen ist.*)
b) Der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags könnte der Behörde insofern keine verbesserten Vollzugsmöglichkeiten verschaffen. Mit lediglich potentiellen zukünftigen Anlagenbetreibern kann im Vorfeld eines Genehmigungsverfahrens ohnehin kein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden.*)
2. Die Tatsache, dass der Abstand zwischen einer Windenergieanlage und einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken nur knapp mehr als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage beträgt, begründet nach dem insofern eindeutigen Wortlaut des § 249 Abs. 10 BauGB keine Ausnahme von der gesetzlichen Regel, dass eine optisch bedrängende Wirkung nicht vorliegt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 1045
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 06.11.2024 - 4 A 2279/22
1. Das Mindestabstandsgebot für Wettvermittlungsstellen zu öffentlichen Schulen bzw. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist mit der unionsrechtlich garantierten Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit (Art. 49, 56 AEUV) sowie dem Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar.*)
2. Das Mindestabstandsgebot fördert die Begrenzung des lokalen Sportwettangebots durch Reduzierung der Verfügbarkeit. Daneben trägt es zum Schutz von Minderjährigen in dem alltäglichen näheren Umfeld von Einrichtungen, die von ihnen besonders häufig aufgesucht werden, dazu bei, einen Gewöhnungseffekt für Kinder und Jugendliche an die Existenz von Wettvermittlungsstellen zu vermeiden.*)
3. Die Einführung des Mindestabstandsgebots in Nordrhein-Westfalen verstößt nicht gegen das unions- und verfassungsrechtliche Gebot des Vertrauensschutzes. Auch wenn sich die im März 2013 geschaffene frühere Mindestabstandsregelung in § 22 Abs. 1 GlüSpVO im Nachhinein als unwirksam herausgestellt hatte, mussten Betreiber von Wettvermittlungsstellen zumindest mittelfristig mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestabstands auch zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Zuge einer unionsrechtskonformen Regulierung rechnen.*)
4. Ausgehend von der gefestigten und nicht unklaren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wahrt das Mindestabstandsgebot das unionsrechtliche Kohärenzgebot. Es ist nicht erkennbar, dass der Landesgesetzgeber und die die glücksspielrechtlichen Regelungen ausführenden Landesbehörden in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die Sportwettenvermittlung selbst oder in Bezug auf andere Formen des Glücksspiels eine Politik verfolgen, die eher darauf abzielt, zur Teilnahme hieran zu ermuntern, als darauf, die Spielgelegenheiten zu verringern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer Weise zu begrenzen. Die Eröffnung weiterer Spielbanken im Land bietet keinen Anlass zu der Annahme, dass die mit der Schaffung des Mindestabstandsgebots verfolgte Zielrichtung nicht mehr wirksam verfolgt werde.*)
5. Die wegen unterschiedlicher Bestandsinteressen geringfügig verschieden ausgestalteten Übergangsregelungen für Bestandswettvermittlungsstellen und Bestandsspielhallen sind nicht Ausdruck einer angebotserweiternden Glücksspielpolitik.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 14. April
IBRRS 2025, 1026 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 01.04.2025 - 7 A 1242/23
1. Für einen Bebauungszusammenhang i.S.d. § 34 BauGB ist entscheidend, ob und inwieweit eine tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung trotz etwa vorhandener Baulücken nach der Verkehrsauffassung den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt und die zur Bebauung vorgesehene Fläche (noch) diesem Zusammenhang angehört.
2. Wie eng die Aufeinanderfolge von Baulichkeiten sein muss, um sich noch als zusammenhängende Bebauung darzustellen, ist nicht nach geographisch-mathematischen Maßstäben, sondern aufgrund einer umfassenden Bewertung des im Einzelfall vorliegenden konkreten Sachverhalts zu entscheiden.
 Volltext
Volltext
Online seit 11. April
IBRRS 2025, 0977 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.03.2025 - 2 L 6/25
1. Aus der früheren Nutzung eines Grundstücks für Aufgaben einer Straßenmeisterei kann ein Bestandsschutz, der auch eine private gewerbliche Nutzung umfasst, nicht abgeleitet werden.*)
2. Die Darstellung eines Grundstücks als Grünfläche in einem Flächennutzungsplan ist nicht schon deshalb funktionslos oder unbeachtlich, weil auf dem Grundstück bauliche Anlagen vorhanden sind.*)
3. Der Begriff der gewerblichen oder gewerbeähnlichen Nutzung ist hinreichend bestimmt.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 10. April
IBRRS 2025, 1012 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 25.02.2025 - 4 BN 18.24
1. Bei der Überplanung eines gewachsenen Nebeneinanders unverträglicher Nutzungen muss sich die Bebauungsplanung um eine Bewältigung der Situation bemühen und den Konflikt möglichst vermeiden oder jedenfalls vermindern und darf ihn nicht verschärfen. Das gilt erst recht, wenn die Gemeinde durch ihre eigene Planung derartige Störungen in rechtlich zulässiger Weise ermöglichen will.
2. Ein Fehler im Abwägungsergebnis liegt vor, wenn sich die planerische Lösung der Gemeinde unter keinem denkbaren Gesichtspunkt begründen lässt. Dies ist anzunehmen, wenn eine fehlerfreie Nachholung der erforderlichen Abwägungsentscheidung schlechterdings nicht zum selben Ergebnis führen könnte, weil andernfalls der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen würde, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht, mithin die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit überschritten würden.
3. Anders als Mängel im Abwägungsvorgang ist ein Mangel im Abwägungsergebnis stets beachtlich. Er führt unabhängig vom Vorliegen weiterer Mängel der Abwägung zur (Teil-)Unwirksamkeit des Bebauungsplans. Ob eine gemeindliche Planung an einem solchen schwerwiegenden Mangel leidet, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalls und ist einer verallgemeinerungsfähigen, rechtsgrundsätzlichen Klärung nicht zugänglich.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0919
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 04.02.2025 - 1 N 23.1343
1. Unterliegt ein Vorhaben unabhängig von der Lage der Flächen im Innen- oder Außenbereich einer UVP-Vorprüfungspflicht, kann ein beschleunigtes Verfahren nicht darauf gestützt werden, dass es sich lediglich um eine Angebotsplanung ohne konkrete planerische Festsetzungen handele, deren nähere Prüfung einem künftigen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben könne, weil es auf den Grad der Konkretisierung des in den Blick genommenen Vorhabens nicht (mehr) ankommt.
2. Die allgemeine Vorprüfung gilt als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie nach den Vorgaben von § 3c UVPG a.F. durchgeführt worden ist und das Ergebnis der Vorprüfung nachvollziehbar ist (hier verneint).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0980
 Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 17.03.2025 - 2 L 42/24
1. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts nach den §§ 24 ff. BauGB handelt es sich in der Regel nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, das der Bürgermeister nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KomVerfG-SA in eigener Verantwortung erledigt. Deshalb ist für die Anhörung der Parteien des Kaufvertrags auch der Gemeinderat gemeindeintern sachlich zuständig.*)
2. Die Frist des § 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB beginnt mit der Mitteilung des Inhalts des Kaufvertrags i. S. des § 28 Abs. 1 Satz 1 BauGB an die Gemeinde durch den Verkäufer oder den Käufer zu laufen. Wird der Gemeinde ein noch genehmigungsbedürftiger Kaufvertrag übersandt, muss zu gegebener Zeit die Erteilung der Genehmigung oder der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach § 145 Abs. 1 Satz 1 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB mitgeteilt werden; erst dann beginnt die Frist zu laufen. Dies gilt auch dann, wenn die für die Erteilung der Genehmigung zuständige Behörde eine Dienststelle der vorkaufsberechtigten Gemeinde ist.*)
3. Der Ausschlusstatbestand des § 26 Nr. 4 Alt. 2 BauGB setzt voraus, dass sowohl die Nutzungsabsichten der Eigentümer des Kaufgrundstücks als auch die Zielvorstellungen und Zwecke der Sanierungsmaßnahme hinreichend präzisiert und konkretisiert worden sind.*)
4. Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist durch das Wohl der Allgemeinheit nicht mehr gerechtfertigt, wenn die Gemeinde die in der Sanierungssatzung aufgestellten Sanierungsziele, denen die Ausübung des Vorkaufsrechts dienen soll, nach mehr als 25 Jahren im Verlauf des Sanierungsverfahrens nicht hinreichend präzisiert und konkretisiert hat.*)
 Volltext
Volltext