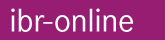Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
IBR 08/2022 - Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Bauvertragsrecht gibt es – neben zahlreichen anderen – zwei Themen, die immer wieder nicht nur die Gemüter der Baubeteiligten erhitzen, sondern auch in Rechtsprechung und Schrifttum zu mitunter schon emotional geführten Auseinandersetzungen führen: Nachträge bei lückenhafter Leistungsbeschreibung und Rechtsfragen rund um den Baugrund.
Die Leistungsbeschreibung im technischen Sinn als Herz- oder Kernstück des Bauvertrags weist oft nicht die vom Auftraggeber gewünschte Richtigkeit oder Vollständigkeit auf. Das ist verständlich, aber letztlich unvermeidbar, weil Menschen nun einmal Fehler machen. Gleichwohl stellt sich die Frage, wer die damit verbundenen finanziellen und terminlichen Konsequenzen zu tragen hat. Bei ihrer Beantwortung trifft man auf die Formulierung, dass dem Auftragnehmer kein Anspruch auf Mehrvergütung zusteht, wenn die Leistungsbeschreibung lückenhaft ist und der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Vertragsschluss darauf nicht hingewiesen hat (so. z. B. OLG Celle,  IBR 2019, 601). Ein solche Sichtweise ist aber nicht zwingend (ausführlich Bolz, NZBau 2021, 83 ff.). Sie lässt sich insbesondere nicht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stützen. Denn lückenhaft ist danach nicht eine technisch unvollständige, sondern eine kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung (BGH, NJW-RR 1987, 1306). Nur die kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung hat der Bieter aufzuklären. Unterlässt er dies, kann er als Auftragnehmer keine Mehrvergütung verlangen, wenn er über die von ihm kalkulierte Ausführung hinaus Mehrleistungen erbringen muss. Darauf weist das OLG Karlsruhe hin (
IBR 2019, 601). Ein solche Sichtweise ist aber nicht zwingend (ausführlich Bolz, NZBau 2021, 83 ff.). Sie lässt sich insbesondere nicht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stützen. Denn lückenhaft ist danach nicht eine technisch unvollständige, sondern eine kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung (BGH, NJW-RR 1987, 1306). Nur die kalkulatorisch unklare Leistungsbeschreibung hat der Bieter aufzuklären. Unterlässt er dies, kann er als Auftragnehmer keine Mehrvergütung verlangen, wenn er über die von ihm kalkulierte Ausführung hinaus Mehrleistungen erbringen muss. Darauf weist das OLG Karlsruhe hin ( S. 387).
S. 387).
Unübersichtlich wird es auch, wenn es um Fragen rund um den Baugrund geht. Weil Bauen ohne Baugrund (angeblich) nicht geht (sog. schwimmende Häuser belegen das Gegenteil), wird der Baubranche seit Jahrzehnten u. a. mit der Begründung, der Baugrund gehöre anders als der Baubetrieb nicht zur Sphäre des Auftragnehmers, vom herrschenden baurechtlichen Schrifttum „verkauft“, der Auftraggeber habe als Eigentümer des Grundstücks und Veranlasser der Baumaßnahme für sämtliche mit dem Baugrund verbundenen Risiken einzustehen. Das klingt gut, ist aber schlichtweg nicht richtig. Baugrundrisiken sind grundsätzlich Auftragnehmerrisiken (siehe z. B. BGH,  IBR 2016, 325; OLG München,
IBR 2016, 325; OLG München,  IBR 2015, 114; ausführlich Bolz, NJW 2022, 1709 ff.). Nur wenn der Auftraggeber den Baugrund beschreibt und sich der Boden anders als beschrieben darstellt, realisiert sich ein Risiko, das vom Auftraggeber zu tragen ist (BGH,
IBR 2015, 114; ausführlich Bolz, NJW 2022, 1709 ff.). Nur wenn der Auftraggeber den Baugrund beschreibt und sich der Boden anders als beschrieben darstellt, realisiert sich ein Risiko, das vom Auftraggeber zu tragen ist (BGH,  IBR 2013, 328;
IBR 2013, 328;  IBR 2009, 630). Dies ist aber keine Besonderheit des Baugrunds. Das Risiko der Richtigkeit der Leistungsbeschreibung trägt immer der Auftraggeber, sofern die Vertragsparteien nichts anderes (wirksam) vereinbart haben (vgl. OLG Frankfurt,
IBR 2009, 630). Dies ist aber keine Besonderheit des Baugrunds. Das Risiko der Richtigkeit der Leistungsbeschreibung trägt immer der Auftraggeber, sofern die Vertragsparteien nichts anderes (wirksam) vereinbart haben (vgl. OLG Frankfurt,  IBR 2021, 115). Wird der Baugrund hingegen nicht beschrieben, ist der Aushub des jeweilig vorgefundenen Bodens geschuldet und mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Das hat das OLG Bamberg im Anschluss an BGH,
IBR 2021, 115). Wird der Baugrund hingegen nicht beschrieben, ist der Aushub des jeweilig vorgefundenen Bodens geschuldet und mit den vereinbarten Preisen abgegolten. Das hat das OLG Bamberg im Anschluss an BGH,  IBR 2013, 328, entschieden (
IBR 2013, 328, entschieden ( S. 392).
S. 392).
Im Recht der Architekten und Ingenieure hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 02.06.2022 einen Schlussstrich unter die Diskussion über die Verbindlichkeit der Mindestsätze der HOAI 2013 gezogen. Das Gericht hat entschieden, dass die Vorschrift des § 7 HOAI 2013 nicht richtlinienkonform dahin ausgelegt werden kann, dass die Mindestsätze der HOAI im Verhältnis zwischen Privatpersonen grundsätzlich nicht mehr verbindlich sind und einer die Mindestsätze unterschreitenden Honorarvereinbarung nicht entgegenstehen. Auch aus dem Europarecht ergibt sich keine Verpflichtung, das gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie verstoßende verbindliche Mindestsatzrecht der HOAI 2013 im Rahmen eines Rechtsstreits, in dem sich ausschließlich Privatpersonen gegenüberstehen, nicht anzuwenden ( S. 408). Zudem ist § 7 Abs. 5 HOAI 2013, wonach unwiderlegbar vermutet wird, dass die HOAI-Mindestsätze vereinbart sind, sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, unbeschadet des Urteils des EuGH vom 04.07.2019 (
S. 408). Zudem ist § 7 Abs. 5 HOAI 2013, wonach unwiderlegbar vermutet wird, dass die HOAI-Mindestsätze vereinbart sind, sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, unbeschadet des Urteils des EuGH vom 04.07.2019 ( IBR 2019, 436) weiterhin anwendbar (
IBR 2019, 436) weiterhin anwendbar ( S. 409).
S. 409).
Das bedeutet aber nicht, dass ein Architekt oder Ingenieur stets die Aufstockung seines Honorars verlangen kann, wenn er mit dem Auftraggeber ein Pauschalhonorar unterhalb der HOAI-Mindestsätze vereinbart hat. Ein solches Aufstockungsverlangen kann nach wie vor treuwidrig sein (OLG Celle,  IBR 2022, 352).
IBR 2022, 352).
Im Vergaberecht erleichtert die Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis dem Bieter die Führung des Eignungsnachweises. Das enthebt ihn aber nicht davon, seine technische und berufliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Reichen die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzen im konkreten Fall nicht aus, darf der Auftraggeber weitere als die über das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegten, aber inhaltlich unzureichenden Referenzen nicht nachfordern, so das OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 08.06.2022 ( S. 421).
S. 421).
Auch alle anderen Beiträge empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit.
Mit den besten Grüßen
Ihr
Dr. Stephan Bolz
Rechtsanwalt
Verleger und Schriftleiter der IBR