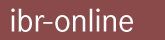Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Aktuelle Urteile zum Öffentlichen Bau- & Umweltrecht
Online seit heute
IBRRS 2025, 3185 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Urteil vom 08.04.2025 - 9 C 1.24
Zu den Voraussetzungen einer Erschließung sogenannter gefangener Hinterliegergrundstücke bei Eigentümeridentität.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 12. Dezember
IBRRS 2025, 3123 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 03.07.2025 - 8 S 1932/23
Ein Normenkontrollantrag gegen eine Vorkaufsrechtssatzung ist regelmäßig unzulässig, soweit er über das Grundstück/die Grundstücke des Antragstellers hinausgreift.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 3189
 Amtshaftung
Amtshaftung
OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.09.2024 - 18 U 196/22
1. Jeder Amtsträger hat die Pflicht, Auskünfte und Belehrungen richtig, klar, unmissverständlich, eindeutig und vollständig zu erteilen, so dass der um sie nachsuchende Bürger als Empfänger der Auskunft entsprechend disponieren kann, wobei diese Amtspflicht auch den Schutzzweck hat, den Empfänger vor schädlichen Vermögensdispositionen zu bewahren, die im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft vorgenommen werden.
2. Der geltend gemachte Schaden muss in den Schutzbereich der wahrzunehmenden Amtspflichten fallen. Gerade das im Einzelfall berührte Interesse muss nach dem Zweck und der rechtlichen Bestimmung des Amtsgeschäfts geschützt werden (hier Schutzzweckzusammenhang verneint zwischen Falschauskunft über Baulasten einerseits und Darlehensgewährung zur Erfüllung einer das Grundstück betreffenden Kaufpreisforderung andererseits).
3. Auch im Amtshaftungsrecht bedarf es eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Amtspflichtverletzung und Schaden. Zu prüfen ist, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten des Amtsträgers genommen hätten und wie sich in diesem Falle die Vermögenslage des Verletzten darstellen würde.
 Volltext
Volltext
Online seit 11. Dezember
IBRRS 2025, 3175 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Urteil vom 16.09.2025 - 4 CN 2.24
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO ermächtigt die Gemeinde nicht zu Festsetzungen der zulässigen Grundfläche für einzelne Anlagentypen, sondern verlangt eine einheitliche Festsetzung für alle baulichen Anlagen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 10. Dezember
IBRRS 2025, 3129 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19.11.2025 - 14 S 103/25
1. § 6 UmwRG ist auf Klagen, mit denen sich ein Vorhabenträger – hier der Betreiber einer Windenergieanlage (WEA) – gegen belastende Nebenbestimmungen einer ihm erteilten Genehmigung wendet, nicht anwendbar (Anschluss an VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19.03.2025 - 10 S 1411/23 - ZNER 2025, 245, m. w. N.).*)
2. Zur Frage, ob es ermessensfehlerhaft ist, in einem Bescheid über die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer WEA die Sicherheitsleistung für deren Rückbau gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB in einer Höhe festzusetzen, die nicht nur den Fall eines (kostengünstigeren) Rückbaus durch Sprengung der WEA, sondern auch den Fall eines herkömmlichen (kostenintensiveren) Rückbaus durch Demontage abdeckt (hier Ermessensfehler verneint).*)
3. Der Betreiber einer WEA, ist, wenn er im Einzelfall Arbeitgeber im Sinne von § 2 Abs. 2 ArbSchG ist, gemäß § 5 Abs. 1 ArbSchG zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung verpflichtet. Er kann sich dieser Pflicht nicht durch den Abschluss von Verträgen mit dem Hersteller der WEA, wonach der Hersteller und nicht der Betreiber die Wartung der WEA übernimmt, entledigen, sondern hat umgekehrt sicherzustellen, dass er, falls erforderlich, von dem Hersteller die notwendigen Angaben zur WEA erhält, um seine arbeitsschutzrechtliche Pflicht aus § 5 Abs. 1 ArbSchG erfüllen zu können.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 9. Dezember
IBRRS 2025, 3128 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 06.11.2025 - 5 S 695/24
1. Die Zustimmung der Gemeinde zur Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 3 BauGB muss im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vorliegen.*)
2. Entsprechendes gilt für eine Abweichung nach § 246 e Abs. 1 BauGB.*)
3. Das Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde nach § 31 Abs. 3 BauGB und gemäß § 246 e Abs. 1 und 2 BauGB dient der Wahrung und Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit. Das gerichtliche Verfahren ist zur Entscheidung der Gemeinde über die Erteilung der Zustimmung auch nicht in entsprechender Anwendung des § 94 VwGO auszusetzen, wenn bereits nach Aktenlage feststeht, dass das Vorhaben mit den planerischen Vorstellungen der Gemeinde nicht vereinbar ist.*)
4. Wird die Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Bauvorbescheids aus anderen als planungsrechtlichen Gründen zu Unrecht abgelehnt, obwohl die Voraussetzungen für den Erlass einer Veränderungssperre oder einer Zurückstellung vorliegen, besteht kein Anlass, zum Schutz der kommunalen Planungshoheit von einer Anrechnung der "faktischen" Zurückstellung auf die Geltungsdauer einer später erlassenen Veränderungssperre abzusehen (Abgrenzung zu VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 26.05.2020 - 8 S 1081/19 -, VBlBW 2020, 519).*)
 Volltext
Volltext
Online seit 8. Dezember
IBRRS 2025, 3127 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Hessen, Beschluss vom 05.11.2025 - 5 B 808/25
1. Eine im vereinfachten Verfahren erteilte Baugenehmigung kann weder wegen einer Verletzung von Vorschriften, die nicht zum Prüfprogramm gehören rechtswidrig werden, noch führt ein Verstoß gegen derartige nachbarschützende Vorschriften automatisch zur Rücksichtslosigkeit des Vorhabens im Sinne des § 15 BauNVO.*)
2. Zu den Voraussetzungen einer abstandsflächenrechtlichen Privilegierung nach § 6 Abs. 6 Satz 4 Nr. 1 HBO für nachträglich angebaute Aufzüge.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 5. Dezember
IBRRS 2025, 3080 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 21.11.2025 - 1 ME 92/25
1. Der Umstand, dass gut sieben Wochen nach Satzungsbeschluss noch keine Bekanntgabe erfolgt ist, lässt jedenfalls bei einem Bebauungsplan, dessen Rechtmäßigkeit umstritten ist, die für eine Baugenehmigungserteilung nach § 33 Abs. 1 BauGB erforderliche materielle Planreife regelmäßig nicht entfallen.*)
2. Jedenfalls Änderungen des Umweltberichts, die lediglich zusätzliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufzeigen, erfordern keine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung.*)
3. Nr. 18.7 der Anlage 1 zum UVPG beschränkt die UVP- bzw. Vorprüfungspflicht nicht auf den für ein Städtebauprojekt aufgestellten Bebauungsplan. Die UVP- bzw. Vorprüfungspflicht besteht auch für das durch diesen Bebauungsplan ermöglichte Städtebauprojekt selbst, sofern es die in der Norm genannte Grundfläche erreicht.*)
4. Wurden sämtliche auf Zulassungsebene relevanten Umweltauswirkungen des Vorhabens bereits im Rahmen der Umweltprüfung für den Bebauungsplan untersucht, so ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung ausnahmsweise entbehrlich. Dies gilt auch, wenn die Baugenehmigung nicht auf der Grundlage von § 30, sondern von § 33 BauGB erteilt werden soll.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 4. Dezember
IBRRS 2025, 3098 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 25.11.2025 - 1 LA 161/24
1. Die nähere Umgebung i.S.v. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Bezug auf das Merkmal der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, und das darin enthaltene Element der Bautiefe in aller Regel auf diejenigen Grundstücke beschränkt, die durch die gleiche Erschließungsstraße erschlossen sind und zudem auf der gleichen Straßenseite liegen (Bestätigung der st. Senatsrspr., vgl. Beschluss vom 26.08.2019 - 1 LA 41/19; Urteil vom 01.09.2022 - 1 LB 4/21, IBRRS 2022, 2884 = BauR 2023, 53 = BRS 90 Nr. 59).*)
2. Eine Abweichung vom Erfordernis des Einfügens gemäß § 34 Abs. 3a Satz 1 BauGB darf nur im Einzelfall, also nur in atypischen Sonderfällen erfolgen.*)
3. Ein Planerfordernis, das eine Abweichung in mehreren vergleichbaren Fällen gemäß § 34 Abs. 3a Satz 3 BauG ausschließt, kann dann bestehen, wenn die erstmalige Zulassung eines Vorhabens im bislang unbebauten rückwärtigen Grundstücksbereich Vorbild für weitere Bauvorhaben wäre und aufgrund dessen die rückwärtige Ruhezone mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft in Bewegung geriete.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 3. Dezember
IBRRS 2025, 3072 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Urteil vom 25.03.2025 - 4 C 1.24
1. Ob ein bestimmtes Gebiet sanierungsbedürftig ist und ob seine Sanierung aus der maßgeblichen Sicht der Gemeinde erforderlich ist, lässt sich abschließend nur unter Berücksichtigung des - seinerseits auf einer Abwägung beruhenden - Sanierungskonzepts und aller übrigen öffentlichen und privaten Belange (§ 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB), also im Wege einer Abwägung, entscheiden (im Anschluss an BVerwG, Urteil vom 04.03.1999 - 4 C 8.98, IBRRS 2003, 2171 = Buchholz 406.11 § 142 BauGB Nr. 5 und Beschluss vom 24.03.2010 - 4 BN 60.09, IBRRS 2010, 1720 = Buchholz 406.11 § 136 BauGB Nr. 7).*)
2. Bei der Beurteilung, ob die Sanierung durchgeführt ist, steht der Gemeinde ein Einschätzungsspielraum zu, der aus ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit für das Sanierungskonzept folgt. Ob die Sanierung durchgeführt ist, beurteilt sich daher nach der jeweiligen städtebaulichen Situation, den von der Gemeinde formulierten Sanierungszielen, dem darauf aufbauenden Sanierungskonzept und dem Grad seiner Verwirklichung. Dabei ist auf das Sanierungskonzept der Gemeinde im Zeitpunkt der Aufhebung der Sanierungsverordnung abzustellen.*)
3. Bei der Prüfung, ob eine Bodenwerterhöhung sanierungsbedingt ist, bedarf es keiner Betrachtung der fiktiven Eigenentwicklung ohne den Erlass der Sanierungsverordnung.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2. Dezember
IBRRS 2025, 3071 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 13.03.2025 - 1 C 11067/22
1. Die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 KomZG (ZwVerbG RP) notwendige Bestimmung der Aufgabe eines Zweckverbandes durch die Verbandsordnung erfordert regelmäßig auch die Festlegung eines räumlichen Aufgabenbereichs im Sinne eines Verbandsgebiets, wenn der Zweckverband Aufgaben der verbindlichen Bauleitplanung wahrnehmen soll.*)
2. Werden die zu einem Bebauungsplan gehörenden zeichnerischen Festsetzungen nicht gesondert ausgefertigt, muss durch eindeutige Angaben im ausgefertigten Satzungstext jeder Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zur Satzung ausgeschlossen sein. Ein Rückbezug der nicht ausgefertigten Pläne auf den ausgefertigten Teil der Satzung vermittelt hingegen nicht die erforderliche Authentizität (im Anschluss an VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.09.1993 -5 S 800/92 -; OVG Sachsen, Urteil vom 23.10.2000 - 1 D 33/00).*)
3. Eine Worst-Case-Betrachtung, die der Prognose von infolge einer Planung (hier: großflächiger Möbeleinzelhandel) in Nachbargemeinden zu erwartenden Kaufkraftverlusten dient, darf auch bei einem Angebotsbebauungsplan auf die Flächenproduktivitätswerte eines bestimmten Betreibers abstellen, soweit auf Grund der konkreten Umstände des Einzelfalles die Annahme realistisch erscheint, dass sich dieser und nicht etwa ein Betreiber mit einer deutlich höheren Flächenproduktivität im Plangebiet ansiedeln wird.*)
4. Zur Antragsbefugnis einer Nachbargemeinde im Normenkontrollverfahren gegen einen Bebauungsplan zur Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel (hier: Möbelhaus)*)
5. Zur Auslegung eines Zielabweichungsbescheids (hier: keine Feststellung hinsichtlich der Vereinbarkeit der Planung mit dem Nichtbeeinträchtigungsgebot, sog. Negativattest)*)
 Volltext
Volltext
Online seit 1. Dezember
IBRRS 2025, 3068 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15.05.2025 - 10 D 203/22
1. Liegen die Voraussetzungen des § 13a BauGB vor, liegt die Entscheidung, ob die Gemeinde das beschleunigte Verfahren wählt, in ihrem planerischen Ermessen.*)
2. Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die gesetzlich vorgesehene einmonatige Auslegung der Planunterlagen ganz oder teilweise während der Schulferien erfolgt.*)
3. Die Gemeinde kann auch dann innerhalb ihres Planungsermessens zwischen Angebotsbebauungsplan und vorhabenbezogenem Bebauungsplan wählen, wenn der Bebauungsplan die planungsrechtliche Grundlage für ein konkretes Vorhaben eines bestimmten Vorhabenträgers sein soll.*)
4. Der Gemeinde steht es frei, einen Angebotsbebauungsplan mit einem städtebaulichen Vertrag, in dem der Vorhabenträger bestimmte Aufgaben übernimmt, zu kombinieren.*)
5. Die städtebauliche Erforderlichkeit i. S. v. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB für die Festsetzung eines bestimmten Baugebiets nach der Baunutzungsverordnung kann dann fehlen, wenn die Verwirklichung des Baugebiets objektiv ausgeschlossen ist oder das festgesetzte Baugebiet mit seiner allgemeinen Zweckbestimmung vom Plangeber tatsächlich nicht gewollt war, sondern nur vorgeschoben wurde, um das eigentliche (unzulässige) Planungsziel zu verdecken (sog. Etikettenschwindel).*)
6. Das urbane Gebiet weist - mit dem Wohnen einerseits sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören, anderseits - zwei Hauptnutzungen auf.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 28. November
IBRRS 2025, 3062 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 13.11.2025 - 2 CS 25.1851
1. Bei den kommunalen Vorschriften der Baumschutzverordnung handelt es sich um umweltbezogene Rechtsvorschriften des Landesrechts.
2. Bei der Rüge der Verletzung der Baumschutzverordnung kann sich der Antragsteller auch auf die Verletzung von Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, also nicht originär umweltbezogene Vorschriften, berufen.
3. Bei der Frage, ob eine rückwärtige Bebauung eines Grundstücks nach der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig ist, kommt es regelmäßig darauf an, in welchem Umfang die den Maßstab bildenden umliegenden Grundstücke eine rückwärtige Bebauung aufweisen. Dabei ist die Reichweite der näheren Umgebung auf diejenigen Grundstücke beschränkt, die durch die gleiche Erschließungsstraße erschlossen sind und in der Regel auch auf der gleichen Straßenseite liegen.
4. Grundsätzlich nehmen an der Bindungswirkung des Vorbescheides nur die im Vorbescheid ausdrücklich im Sinne einer positiven Entscheidung geklärten Aspekte der Bauvoranfrage teil. Auf Fragen, zu denen der Vorbescheid nichts aussagt, erstreckt sich die Bindungswirkung des Vorbescheides nicht.
 Volltext
Volltext
Online seit 27. November
IBRRS 2025, 3037 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 26.03.2025 - 3 LB 13/21
1. Es sprechen erhebliche Gründe gegen die Annahme, dass bei der Bestimmung der maßstabsbildenden Bebauung i. S. des § 34 Abs. 1 BauGB Ferienhäuser generell unberücksichtigt zu bleiben haben. Die Bewertung von Wochenendhäusern dürfte im Hinblick auf die Unterschiede in Nutzungszweck und typischem Erscheinungsbild nicht auf Ferienhäuser zu übertragen sein.*)
2. Zum Einzelfall eines nach § 35 Abs. 2 BauGB zulässigen Nebengebäudes, das nicht die Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lässt.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 26. November
IBRRS 2025, 3051 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 18.11.2025 - 1 LA 107/25
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB setzt voraus, dass das aufgrund zulässiger Errichtung bestandsgeschützte Wohngebäude trotz der Erweiterung in seinen identitätsprägenden Bestandteilen fortbesteht. Das schließt eine weitgehende oder gar vollständige Beseitigung der Bausubstanz des Bestandsgebäudes aus.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 25. November
IBRRS 2025, 2763 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 09.10.2025 - 10 S 8/25
1. Welchen Inhalt die von einer Behörde abgegebene Erklärung hat, bestimmt sich nach den für die Auslegung von Willenserklärungen geltenden Maßstäben (hier zur Frage, ob eine Ordnungsverfügung durch einen Widerspruchsbescheid aufgehoben oder nur abgeändert wurde).
2. Eine der verfügten Maßnahme entgegenstehende zivilrechtliche Rechtsposition Dritter (hier: Mieter) berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung, sondern stellt lediglich ein Vollzugshindernis dar, welches nachträglich - d.h. vor Festsetzung bzw. Anwendung des jeweiligen Zwangsmittels - durch eine gegen diesen Dritten gerichtete Duldungsverfügung ausgeräumt werden kann.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 2825
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Beschluss vom 25.08.2025 - 9 E 25.4331
1. Ein Anspruch des Antragstellers als Nachbar auf bauaufsichtliches Einschreiten folgt aber nicht aus jedem erdenklichen Rechtsverstoß, vielmehr muss die verletzte Norm nachbarschützenden Charakter haben.
2. Eine inzidente Überprüfung des Bebauungsplans im einstweiligen Rechtsschutzverfahren (hier: gerichtet auf Verpflichtung zum bauaufsichtlichen Einschreiten) kann regelmäßig nur eingeschränkt erfolgen. Es müssen offensichtliche Fehler vorliegen.
 Volltext
Volltext
Online seit 24. November
IBRRS 2025, 2760 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 14.10.2025 - 15 CS 25.963
Die abstandsflächenrechtliche Privilegierung für Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten gilt unabhängig von deren Zweckbestimmung.
 Volltext
Volltext
Online seit 21. November
IBRRS 2025, 2985 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Urteil vom 21.10.2025 - 12 KN 4/25
1. Eine Feststellung nach § 5 Abs. 2 WindBG steht der Zulässigkeit eines Antrags nach § 47 VwGO gegen die - noch vor dem Februar 2024 beschlossene - Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bezogen auf Windenergieanlagen jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Rechtmäßigkeit der Feststellung ihrerseits von der Rechtmäßigkeit der im Normenkontrollverfahren streitigen Planänderung abhängen kann.*)
2. Eine Teilgenehmigung nach § 6 Abs. 3 BauGB einer Konzentrationsflächenplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB durch Herausnahme einzelner Sondergebiete für die Windenergienutzung ist rechtswidrig, wenn aus ihr nicht deutlich wird, welche Reichweite die Ausschlusswirkung fortan haben soll, und zudem nicht feststeht, dass der Planungsträger die Ausschlusswirkung auch mit einer geringeren Zahl von Sondergebieten gebilligt hätte.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 20. November
IBRRS 2025, 2986 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Urteil vom 11.09.2025 - 7 C 10.24
1. Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung stellt eine endgültige Entscheidung im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 3 WindBG dar. Auf die Bestandskraft dieser Genehmigung kommt es nicht an.*)
2. Die Prüfung, ob der Erteilung einer Genehmigung ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entgegensteht, ist auf die naturräumlichen Gegebenheiten einschließlich der faunistischen Ausstattung im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung beschränkt.*)
3. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist - über eine durchgeführte Vorprüfung hinaus - erforderlich, wenn und soweit Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets nicht offensichtlich ausgeschlossen werden können, also zumindest vernünftige Zweifel am Ausbleiben von erheblichen Beeinträchtigungen bestehen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 2826
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Urteil vom 11.08.2025 - 8 K 23.3977
Ist ein unbeplanter Innenbereich in offener Bauweise bebaut, weil dort nur Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen den maßgeblichen Rahmen bilden, fügt sich ein grenzständiges Vorhaben grundsätzlich nicht nach der Bauweise ein, wenn es unter Beseitigung eines bestehenden Doppelhauses grenzständig errichtet wird, ohne mit dem verbleibenden Gebäudeteil ein Doppelhaus zu bilden (sog. Doppelhausrechtsprechung).
 Volltext
Volltext
Online seit 19. November
IBRRS 2025, 2924 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 29.09.2025 - 22 D 268/24
1. Ein unter Missachtung des absoluten Beteiligungsrechts der Gemeinde nach § 36 BauGB erteilter Vorbescheid nach § 9 BImSchG ist ohne Überprüfung seiner materiellen Rechtmĭßigkeit aufzuheben - und zwar auch dann, wenn die Kommune bei zutreffender Beurteilung des Vorhabens verpflichtet gewesen wäre, ihr Einvernehmen zu erteilen.*)
2. Nicht jede Veränderung eines Vorhabens, zu dem die Beteiligung erfolgt ist, löst eine erneute Beteiligungspflicht aus. Voraussetzung hierfür ist vielmehr, dass durch die Veränderung bauplanungsrechtliche Belange, die bei der Frage der Einvernehmenserteilung zu berücksichtigen waren, neuerlich berührt oder erstmals so erheblich betroffen werden, dass sich die Zulässigkeitsfrage neu stellt.*)
3. Allein die Umstellung des Verfahrens von einem Antrag nach § 9 Abs. 1 BImSchG auf einen solchen nach § 9 Abs. 1a BImSchG löst eine erneute Beteiligungspflicht regelmäßig nicht aus. Bei den Vorbescheidsverfahren nach § 9 Abs. 1 und Abs. 1a BImSchG handelt es sich nicht um zwei unterschiedliche Verfahrensarten; der Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a BImSchG ist gegenüber demjenigen nach § 9 Abs. 1 BImSchG kein "Aliud", sondern ein "Minus", ein Verfahrenswechsel findet nicht statt.*)
4. Im Verfahren nach § 36 BauGB trifft die Gemeinde eine Mitwirkungsobliegenheit. Kommt sie dieser Mitwirkungslast nicht nach und fordert die aus ihrer Sicht zur vollständigen Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlichen Unterlagen nicht nach, kann sie sich später nicht auf deren Fehlen berufen. Dies gilt namentlich dann, wenn sich die Gemeinde auf der Basis der nunmehr als unzureichend angesehenen Unterlagen in der Lage gesehen hat, ihr Einvernehmen zu versagen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 18. November
IBRRS 2025, 2951 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 09.10.2025 - 1 C 10872/24
1. Die Festsetzungsmöglichkeit gemäß § 9 Abs. 2d Satz 1 Nr. 2 BauGB für einen sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung bezieht sich nur auf die Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen; sie lässt die sonstigen nach § 34 Abs. 1 BauGB bestehenden Nutzungsmöglichkeiten unberührt.*)
2. Wenn Gebäude mit Wohnungen errichtet werden, müssen diese den Tatbestandsmerkmalen des § 9 Abs. 2d Satz 1 Nr. 2 BauGB Rechnung tragen. Mindestens eine Wohnung muss mithin die baulichen Voraussetzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 17. November
IBRRS 2025, 2957 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Urteil vom 11.09.2025 - 7 C 7.24
Eine geänderte Bewertung bei Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung schon vorhandener Tatsachen ist eine nachträgliche Änderung der Sachlage, wenn diese auf neuen fachlichen Erkenntnissen beruht. Eine derartige Änderung der Sachlage berührt die Rechtmäßigkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht und kann nur dann berücksichtigt werden, wenn diese zu Gunsten des Anlagenbetreibers wirkt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 2923
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Karlsruhe, Urteil vom 08.10.2025 - 2 K 7656/24
1. Im Rahmen des § 12 Abs. 1 BauNVO erfolgt keine Prüfung der Gebietsverträglichkeit (im Anschluss an OVG Niedersachen, IBR 2011, 377). Für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Garagenparks in einem festgesetzten Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) kommt es demgemäß nicht auf die Frage an, ob einzelne Garagen an Private vermietet werden.*)
2. Die strikten Grenzwerte in Nr. 4.2.1 und 4.3.1 der TA Luft für Schwebstaub und Staubniederschlag lassen im Regelfall keinen Raum für eine Einzelfallbetrachtung.*)
 Volltext
Volltext