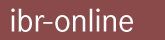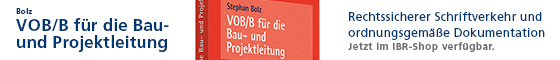Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Aktuelle Urteile zum Öffentlichen Bau- & Umweltrecht
Online seit 13. Februar
IBRRS 2026, 0356 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 15.12.2025 - 4 BN 6.25
1. Die Pflicht zu einer erneuten Auslegung eines Bauleitplans besteht, wenn dessen Entwurf mit den seinen normativen Inhalt ausmachenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen geändert oder ergänzt wird.
2. Diese Pflicht besteht nicht, wenn die nach öffentlicher Auslegung vorgenommene Ergänzung einer Festsetzung lediglich klarstellende Bedeutung hat. Gleiches gilt, wenn der Entwurf in Punkten geändert worden ist, zu denen die betroffenen Bürger, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zuvor bereits Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, die Änderungen auf einem ausdrücklichen Vorschlag eines Betroffenen beruhen und Dritte hierdurch nicht abwägungsrelevant berührt werden.
3. Sog. "Summenpegel" sind unzulässig, gleichwohl können Emissionskontingente festgesetzt werden, die das Emissionsverhalten jedes einzelnen von der Festsetzung betroffenen Betriebes und jeder einzelnen Anlage regeln.
 Volltext
Volltext
Online seit 12. Februar
IBRRS 2026, 0265 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Sachsen, Urteil vom 16.10.2025 - 1 C 32/23
1. Sowohl für die Frage, ob die von den Windkraftanlagen ausgehenden Geräusche zu erheblichen Nachteilen und Belästigungen für die Nachbarschaft führen, als auch für die Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme durch den auf die Wohnhäuser des Nachbarn einwirkenden Lärm sind in ihrem Anwendungsbereich die Bestimmungen der TA Lärm heranzuziehen.
2. Infraschall durch Windkraftanlagen führt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Gehörs nach dem bisherigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich nicht zu Gesundheitsgefahren führt.
3. Der öffentliche Belang einer optisch bedrängenden Wirkung steht einem Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entgegen, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der Windkraftanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der Windkraftanlage entspricht. Eine Abweichung im Einzelfall ist demnach zwar möglich, um unzumutbare Auswirkungen zu verhindern, sie setzt aber einen atypischen, vom Gesetzgeber so nicht vorhergesehenen Sonderfall voraus.
 Volltext
Volltext
Online seit 11. Februar
IBRRS 2026, 0288 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 02.12.2025 - 1 C 10523/24
1. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauGB erlaubt sind nur solche Festsetzungen, bei denen die allgemeine Zweckbestimmung des § 7 Abs. 1 BauNVO gewahrt wird. Dies ist bei einer Festsetzung, wonach sonstige Wohnungen (nur) oberhalb des Erdgeschosses zulässig sind, und einer im Bebauungsplan vorgegebenen Bebauung mit mindestens drei und höchstens vier Geschossen nicht der Fall.*)
2. Ein Bebauungsplan wahrt nicht die Anforderungen an eine dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB genügende Konfliktbewältigung, wenn ein Baugebiet für Fahrzeuge der Abfallentsorgung nicht zugänglich und zugleich unklar ist, wo ein Müll-Sammelplatz im Planvollzug geschaffen werden kann.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 10. Februar
IBRRS 2026, 0263 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18.12.2025 - 2 S 42.25
1. Materielle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung einer Veränderungssperre ist ein Aufstellungsbeschluss. Ein solcher liegt im Rechtssinne allerdings dann nicht vor, wenn er zwar gefasst, aber nicht ortsüblich bekanntgemacht wurde.
2. Ein Bekanntmachungsmangel des Aufstellungsbeschlusses führt zur Unwirksamkeit der Veränderungssperre.
3. Im Falle eines Verstoßes gegen das Erfordernis der ortsüblichen Bekanntmachung eines Aufstellungsbeschlusses ist § 214 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der als Satzung erlassenen Veränderungssperre nicht anwendbar.
 Volltext
Volltext
Online seit 9. Februar
IBRRS 2026, 0301 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 16.12.2025 - 7 B 18.25
1. Das Rücksichtnahmegebot lenkt den Blick auf die konkrete Situation der benachbarten Grundstücke mit dem Ziel, einander abträgliche Nutzungen in rücksichtsvoller Weise einander zuzuordnen sowie Spannungen und Störungen zu verhindern. Dabei ermöglicht und gebietet das Rücksichtnahmegebot zusätzliche Differenzierungen im Wege einer "Feinabstimmung".
2. Bei der Beurteilung von Konfliktsituationen sind faktische Vorbelastungen zu berücksichtigen und es kann auf die Frage ankommen kann, in welchem baurechtlichen Gebiet die vorhandene und die heranrückende Nutzung stattfindet und welche Nutzung eher vorhanden war.
3. Das Tatsachengericht kann sich ohne Verstoß gegen seine Aufklärungspflicht auf Gutachten oder gutachterliche Stellungnahmen stützen, die eine Behörde im Verwaltungsverfahren eingeholt hat. Gleiches gilt für vom Vorhabenträger im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren eingereichte Gutachten oder gutachterliche Stellungnahmen.
4. Ein Verfahrensmangel liegt in dieser Situation nur dann vor, wenn sich dem Tatsachengericht die Einholung eines weiteren Gutachtens hätte aufdrängen müssen, weil die vorliegenden Gutachten ungeeignet sind, ihm die für die richterliche Überzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen zu vermitteln.
 Volltext
Volltext
Online seit 6. Februar
IBRRS 2026, 0289 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29.12.2025 - 7 B 985/25
Das Interesse des Eigentümers eines außerhalb des Planbereichs gelegenen Grundstücks, bei der späteren Realisierung des Bebauungsplans nicht von baustellenbedingten Auswirkungen beeinträchtigt zu werden, gehört wegen der zeitlichen Begrenzung dieser Auswirkungen grundsätzlich nicht zu den Belangen, die in der Abwägung zu berücksichtigen sind. Planbedingt sind nur solche Nachteile, die die Festsetzungen des Bebauungsplans den Betroffenen auf Dauer auferlegen.
 Volltext
Volltext
Online seit 5. Februar
IBRRS 2026, 0261 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 12.12.2025 - 12 MS 43/24
1. Die Rückbaupflicht nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist grundsätzlich umfassend und schließt demnach die Beseitigung unterirdischer Anlagenteile, wie Pfahlgründungen bei Windenergieanlagen, ein. Auch die für solche Beseitigungen voraussichtlich anfallenden Kosten müssen daher durch eine Bürgschaft als Sicherheitsleistung nach § 35 Abs. 5 Satz 3 BauGB abdeckt sein.*)
2. Eine Genehmigung nach § 4 BImSchG für eine Windenergieanlage schließt die Feststellung ihrer Standsicherheit ein. Zu den Grenzen, in denen ein Prüfingenieur für Baustatik insoweit Aufgaben der Genehmigungsbehörde übernehmen kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2026, 0262
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG München, Beschluss vom 13.01.2026 - 1 SN 25.8168
1. Ein Nachbar kann die unzureichende inhaltliche Bestimmtheit einer Baugenehmigung geltend machen, soweit dadurch nicht sichergestellt ist, dass das genehmigte Vorhaben allen dem Nachbarschutz dienenden Vorschriften entspricht.
2. Nach bayerischem Bauordnungsrecht sind die Bauunterlagen mit einem sichtbaren Genehmigungsvermerk zu versehen, der auf dem Lageplan, den Bauzeichnungen, der Baubeschreibung und den technischen Nachweisen anzubringen ist.
3. Nicht mit Genehmigungsvermerk versehene Unterlagen können allenfalls dann zur Auslegung des Inhalts der Baugenehmigung herangezogen werden, wenn anderweitig im Genehmigungsbescheid oder in den Bauvorlagen Bezug auf sie genommen wird.
 Volltext
Volltext
Online seit 4. Februar
IBRRS 2026, 0172 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 02.12.2025 - 2 B 23.1375
1. Der Begriff des landwirtschaftlichen Betriebs erfordert neben der persönlichen Eignung des Betreibers ein auf Dauer angelegtes, mit Gewinnerzielungsabsicht betriebenes und auch zur Gewinnerzielung geeignetes Unternehmen.
2. Die Pensionspferdehaltung ist dadurch gekennzeichnet , dass der unmittelbare Bezug zur Bodenertragsnutzung gelockert und der Übergang von der (noch) landwirtschaftlichen zu einer die Freizeitnutzung ("Reiterhof") in den Vordergrund stellenden gewerblichen Betriebsweise fließend und nur schwer nachprüfbar ist, weshalb eine kritische Prüfung angezeigt ist.
3. Ein landwirtschaftlicher Betrieb setzt eine spezifische betriebliche Organisation und eine Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung voraus. Es muss sich um ein auf Dauer gedachtes und auch lebensfähiges Unternehmen handeln; auch eine landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle kann dabei grundsätzlich ein Betrieb in diesem Sinne sein.
 Volltext
Volltext
Online seit 3. Februar
IBRRS 2026, 0231 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11.12.2025 - 1 A 11292/24
1. Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung enthält nicht konkludent zugleich einen Antrag auf Erteilung der notwendigen Sanierungsgenehmigung (im Anschluss an BVerwG, Beschluss vom 08.03.2001 - 4 B 76.00 -). Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann es der Baugenehmigungsbehörde im Einzelfall aber verwehrt sein, sich auf das Fehlen des sanierungsrechtlichen Antrags zu berufen.*)
2. Die in § 145 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB geregelte Genehmigungsfiktion hinsichtlich der Sanierungsgenehmigung tritt auch bei Versagung des gemeindlichen Einvernehmens ein.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2. Februar
IBRRS 2026, 0156 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Urteil vom 17.09.2025 - 2 B 23.1262
1. Die Anwendung der sog. Doppelhausrechtsprechung scheidet bei geschlossener Bauweise aus.
2. Eine offene Bauweise in Form einer Hausgruppe kann nur vorliegen, wenn deren Länge bezogen auf die jeweils seitlichen Grundstücksgrenzen nicht mehr als 50 m beträgt (hier verneint).
 Volltext
Volltext
Online seit 30. Januar
IBRRS 2026, 0173 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 09.01.2026 - 22 B 1243/25
1. Ob die im Rahmen der Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens von der Genehmigungsbehörde gewährte Anhörungsfrist (noch) angemessen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 02.07.2021 - 7 B 286/21).*)
2. Will sich eine Gemeinde (nachträglich) auf eine nicht ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme zur beabsichtigten Ersetzung ihres versagten Einvernehmens berufen, kann sie nicht zugleich innerhalb des ihr genannten Zeitraums abschließend Stellung nehmen.*)
3. Die zeichnerischen Darstellungen eines Regionalplans sind nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts nur gebiets- und nicht parzellenscharf. Aufgrund dieser Unschärfe bleibt die Zuordnung einzelner Grundstücke in den Randbereichen im Sinne einer zulässigen "Arrondierung" noch interpretierbar und die zeichnerische Darstellung ist nicht als räumlich exakte Abgrenzung zu verstehen.*)
4. Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass ein Regionalplan auch Windenergiegebiete im Sinne des § 2 Nr. 1 WindBG (hier in Gestalt einer Rotor-außerhalb-Planung) umfasst, sowie der damit verbundenen Rechtsfolge des § 249 Abs. 2 BauGB.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 29. Januar
IBRRS 2026, 0155 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 01.10.2025 - 7 D 53/23
1. Verweist eine Festsetzung eines Bebauungsplans auf eine DIN-Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Voraussetzungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich auch vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich Kenntnis verschaffen können. Das kann er dadurch bewirken, dass er die DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereit hält und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinweist.
2. Soweit Bereiche mit unterschiedlichen Schallschutzklassen festgesetzt werden, sind die betreffenden Bereiche in der Planzeichnung eindeutig zu kennzeichnen. Dabei ist auch klarzustellen, für welche Bereiche innerhalb von Baufenstern die jeweiligen Schallschutzklassen gelten sollen.
3. Wenn die Sicherstellung eines ausreichenden passiven Schallschutzes ein in der Bebauungsplanbegründung hervorgehobenes Element der Planungskonzeption war, sind Zweifel daran veranlasst, dass der Bebauungsplan - in Kenntnis von der Unwirksamkeit der Festsetzung zum passiven Lärmschutz - mit den übrigen, den Lärmkonflikt betreffenden Festsetzungen beschlossen worden wäre.
4. Die namentliche Festsetzung eines einzigen zulässigen Nutzers von Gebäuden und Anlagen hat keinen hinreichenden städtebaulichen Bezug und ist in Ermangelung einer Rechtsgrundlage unwirksam. Eine solche Personalisierung ist dem Bauplanungsrecht fremd.
 Volltext
Volltext
Online seit 28. Januar
IBRRS 2026, 0170 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 16.12.2025 - 4 BN 13.25
1. Welcher räumliche Bereich die "nähere Umgebung" ist, lässt sich nicht schematisch, sondern nur nach der jeweiligen tatsächlichen städtebaulichen Situation bestimmen, in die das für die Bebauung vorgesehene Grundstück eingebettet ist
2. Maßstabsbildend ist die Umgebung, insoweit sich die Ausführung eines Vorhabens auf sie auswirken kann und insoweit, als die Umgebung ihrerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst. Dabei ist die nähere Umgebung für die in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Kriterien jeweils gesondert abzugrenzen.
3. Bei der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, kommt es auf die konkrete Größe der Grundfläche der baulichen Anlage und ihre räumliche Lage innerhalb der vorhandenen Bebauung, also auf den Standort des Vorhabens an.
4. Ob eine rückwärtige Bebauung eines Grundstücks zulässig ist, hängt im Wesentlichen davon ab, in welchem Umfang die den Maßstab bildenden umliegenden Grundstücke eine rückwärtige Bebauung aufweisen. Zur näheren Konkretisierung kann insofern auf die Begriffsbestimmungen in § 23 BauNVO zur "überbaubaren Grundstücksfläche", die auch durch Festsetzung der Bautiefe bestimmt werden kann, zurückgegriffen werden.
5. Hiernach ist die Bebauungstiefe von der tatsächlichen Straßengrenze aus zu ermitteln. "Tatsächliche Straßengrenze" ist die Grenze der als Erschließungsanlage gewählten öffentlichen Straße.
 Volltext
Volltext
Online seit 27. Januar
IBRRS 2026, 0169 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 08.12.2025 - 4 BN 9.25
1. "Städtebauliche Gründe" sind Gründe, die sich auf die Entwicklung und Ordnung des Gemeindegebiets beziehen und den in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB aufgeführten Zwecken dienen. Zu diesen zählt auch der Klimaschutz und insbesondere die dem Klimawandel entgegenwirkende Nutzung erneuerbarer Energien.
2. Sie setzen der Bauleitplanung eine erste, wenn auch strikt bindende Schranke, die lediglich grobe und einigermaßen offensichtliche Missgriffe ausschließt. Für die Einzelheiten einer konkreten planerischen Lösung, insbesondere ihrer Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit, ist demgegenüber das Abwägungsgebot maßgeblich, das darauf gerichtet ist, die von der Planung berührten öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen und unverhältnismäßige oder gleichheitswidrige Belastungen zu vermeiden.
3. Es fehlt an städtebaulichen Gründen für eine Festsetzung, wenn diese ersichtlich der Förderung von Zielen dient, für deren Verwirklichung die Planungsinstrumente des Baugesetzbuchs nicht bestimmt sind.
4. Eine Festsetzung dient dem jeweiligen städtebaulichen Ziel, wenn und soweit sie diesem konkret förderlich ist. Einen Beitrag zur Zielförderung kann dabei grundsätzlich auch der Abbau von rechtlichen oder tatsächlichen Realisierungshindernissen bei der Umsetzung der Planung leisten.
 Volltext
Volltext
Online seit 26. Januar
IBRRS 2026, 0126 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Bayern, Beschluss vom 15.01.2026 - 9 ZB 25.1437
1. Die freiberufliche Nutzung (hier: kieferorthopädische Praxis) in Mehrfamilienhäusern, die in einem der genannten Baugebiete liegen, darf nicht mehr als die halbe Anzahl der Wohnungen und nicht mehr als 50% der Wohnfläche pro Gebäude in Anspruch nehmen, wobei es entscheidend darauf ankommt, dass der spezifische Gebietscharakter auch für das einzelne Gebäude gewahrt bleibt.
2. Bei der Ermittlung der 50%-Grenze ist nicht zu beanstanden, wenn nur auf Räume abgestellt wird, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen objektiv geeignet sind und entsprechend genutzt werden; nicht als Aufenthaltsräume sind beispielsweise Flure, Wasch- und Toilettenräume, Heizräume und Garagen.
3. Der in einer Baugenehmigung festgesetzte einzuhaltende Immissionsrichtwert darf die für die Nachbarschaft maßgebliche Zumutbarkeitsgrenze nicht überschreiten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 3235
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Schleswig, Urteil vom 17.09.2025 - 8 A 78/23
1. Die Bauaufsichtsbehörde ist für ein bauaufsichtliches Einschreiten (hier: aufgrund von Lärmimmissionen auf einem Wohngrundstück) grundsätzlich nur noch subsidiär zuständig. Vorrangig zuständig für die Abwehr von Immissionen sind die Immissionsschutzbehörden.
2. Die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde für die Abwehr von Immissionen ist jedoch gegeben, wenn das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme betroffen ist oder es dazu Auflagen in der Baugenehmigung gibt.
3. Der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung ist bereits dann verletzt, wenn die Bauaufsicht ohne hinreichende Ermittlungen über den Antrag auf Einschreiten nicht entscheidet.
 Volltext
Volltext
Online seit 23. Januar
IBRRS 2026, 0125 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 15.01.2026 - 1 MN 99/25
1. Eine Planung, die mit einer Veränderungssperre gesichert werden soll, ist nicht hinreichend konkretisiert, wenn vollkommen offen ist, ob bisher zulässige zentrale Nutzungen wie Wohnen oder produzierendes Gewerbe weiterhin zulässig sein sollen.*)
2. Für die gem. § 11 Abs. 3 Satz 3 NKomVG in der Hauptsatzung zu bestimmende Internetadresse, unter der das elektronische amtliche Verkündungsblatt eingesehen werden kann, genügt die Angabe der Homepage der Gemeinde, wenn von dort aus dieses Verkündungsblatt einfach aufzufinden ist.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 22. Januar
IBRRS 2026, 0124 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Saarland, Beschluss vom 12.01.2026 - 2 A 220/24
Einzelfall, in dem die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht funktionslos geworden sind, weil ein erheblicher Teil der dort vorgesehenen Wohnbebauung bereits verwirklicht wurde bzw. noch realisiert werden kann und die Abweichungen von den Planfestsetzungen nicht so massiv und offenkundig sind, dass der Bebauungsplan seine städtebauliche Gestaltungsfunktion nicht mehr erfüllen kann.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 21. Januar
IBRRS 2026, 0119 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
BVerwG, Beschluss vom 28.11.2025 - 4 BN 8.25
1. Das Rechtsstaatsprinzip gebietet lediglich, dass Rechtsnormen (hier: eine kommunale Stellplatzsatzung) so zu verkünden (bekanntzumachen) sind, dass die Betroffenen sich vom Erlass und vom Inhalt der Rechtsnorm verlässlich Kenntnis verschaffen können und dass diese Möglichkeit der Kenntnisnahme nicht in unzumutbarer Weise erschwert sein darf.
2. Welche Anforderungen im Einzelnen an die Verkündung zu stellen sind, richtet sich nach dem jeweils einschlägigen Recht.
3. Sind die Anforderungen an die Bekanntmachung einer kommunalen Satzung dem Landesrecht (hier: der BekanntmVO-NW) zu entnehmen, dient nur dieses Recht als Beurteilungsmaßstab, wenn der Ortsgesetzgeber den entsprechenden rechtlichen Vorgaben nicht (voll) genügt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2026, 0056
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Frankfurt/Main, Urteil vom 10.12.2025 - 8 K 944/20
Ein Vorhaben mit mehreren für sich genommen unkritischen Änderungen einer Bestandswohnung im Dachgeschoss im Verbund mit der Schaffung einer Maisonettewohnung unter Nutzung des Spitzbodens führt zu einem Konflikt mit der Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Milieuschutzsatzung).
 Volltext
Volltext
Online seit 20. Januar
IBRRS 2026, 0089 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Karlsruhe, Beschluss vom 17.12.2025 - 2 K 7393/25
1. § 15 Abs. 5 Satz 1 AGVwGO, wonach es eines Vorverfahrens nicht in Angelegenheiten nach der Landesbauordnung bedarf, findet auch Anwendung, wenn der maßgebliche Verwaltungsakt zwischen dem 01.06.2025 und dem Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung am 28.06.2025 bekanntgegeben wurde (vgl. § 15 Abs. 5 Satz 2 AGVwGO).*)
2. Für die Anbringung einer nachträglichen Wärmedämmung, die einen geringfügigen Überbau auf das Nachbargrundstück bewirkt, kann nach § 56 Abs. 2 Nr. 3 LBO-BW eine Abweichung von § 4 Abs. 2 LBO-BW und den §§ 5 f. LBO-BW zuzulassen sein.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 19. Januar
IBRRS 2026, 0086 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 05.01.2026 - 1 LA 125/25
1. Die Stellplatzpflicht gemäß § 47 NBauO ist ausschließlich im öffentlichen Interesse angeordnet worden. Daher kann ein Nachbar aus einer Unterschreitung der notwendigen Anzahl von Einstellplätzen nach ständiger Senatsrechtsprechung keine Abwehrrechte herleiten.*)
2. Die mit einer rechtlich zulässigen Bebauung verbundenen Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten durch An- und Abfahrtsverkehr sind im Regelfall hinzunehmen. Die Grenze zur Rücksichtslosigkeit ist erst dann überschritten, wenn die Beeinträchtigungen und Störungen aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse das vorgenannte Maß handgreiflich überschreiten und sich in der Umgebung des Baugrundstücks als unzumutbar darstellen. Dabei ist grundsätzlich ein rechtskonformes Verhalten der Nutzer (oder Dritter) anzunehmen. Ein mögliches rechtswidriges Verhalten kann einem Vorhaben nur dann zugerechnet werden, wenn es sich als dessen mit hinreichender Sicherheit zu erwartende, vom Vorhaben geradezu herausgeforderte Folge darstellt.*)
 Volltext
Volltext